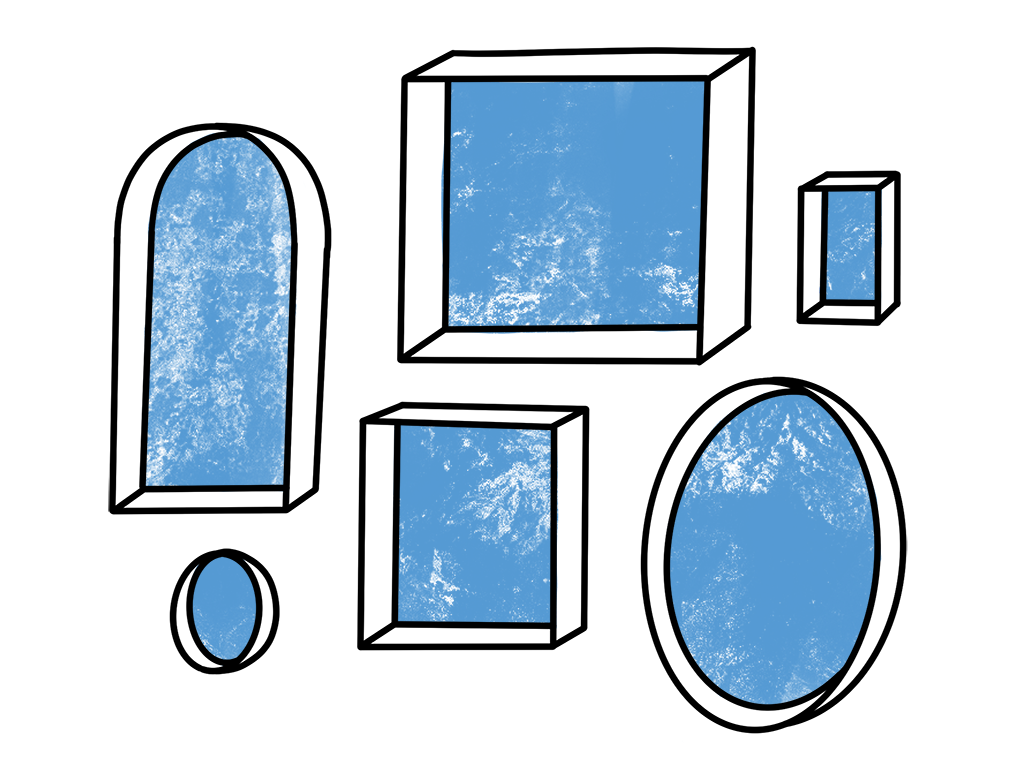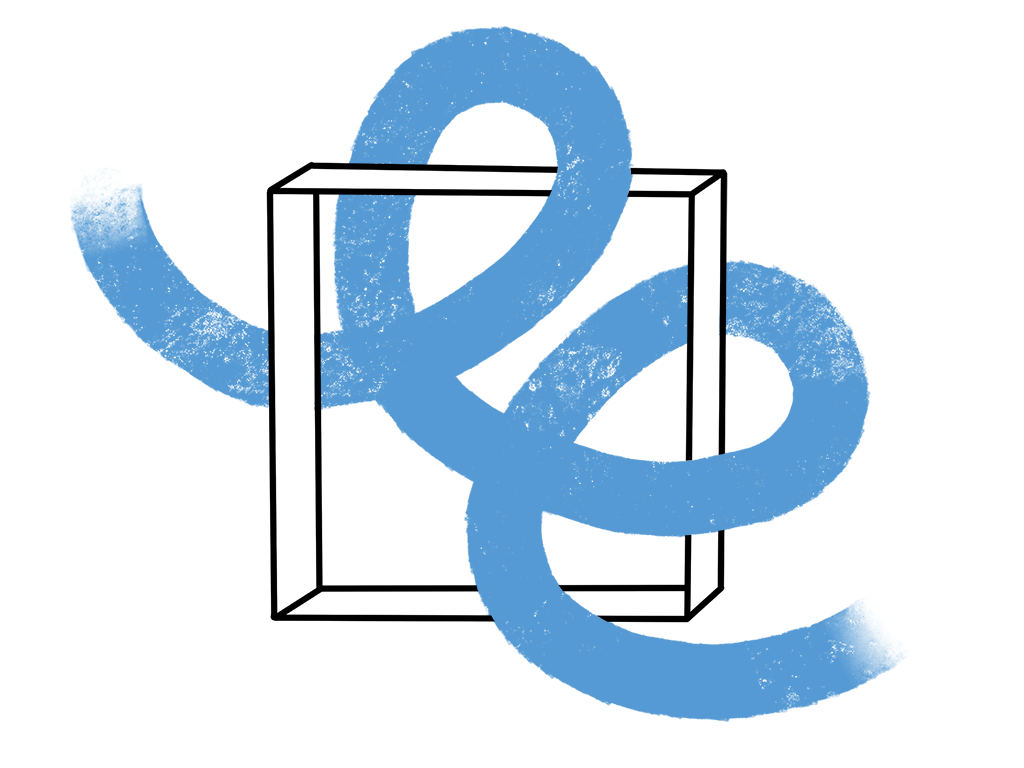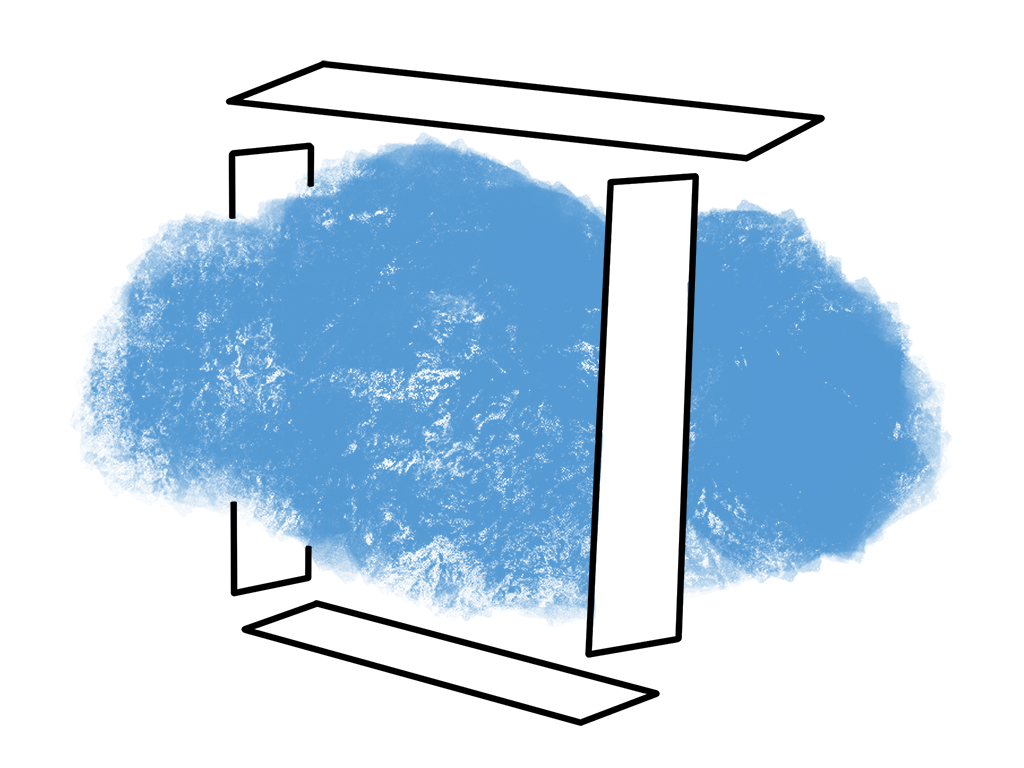Wissenskanon und Curriculum
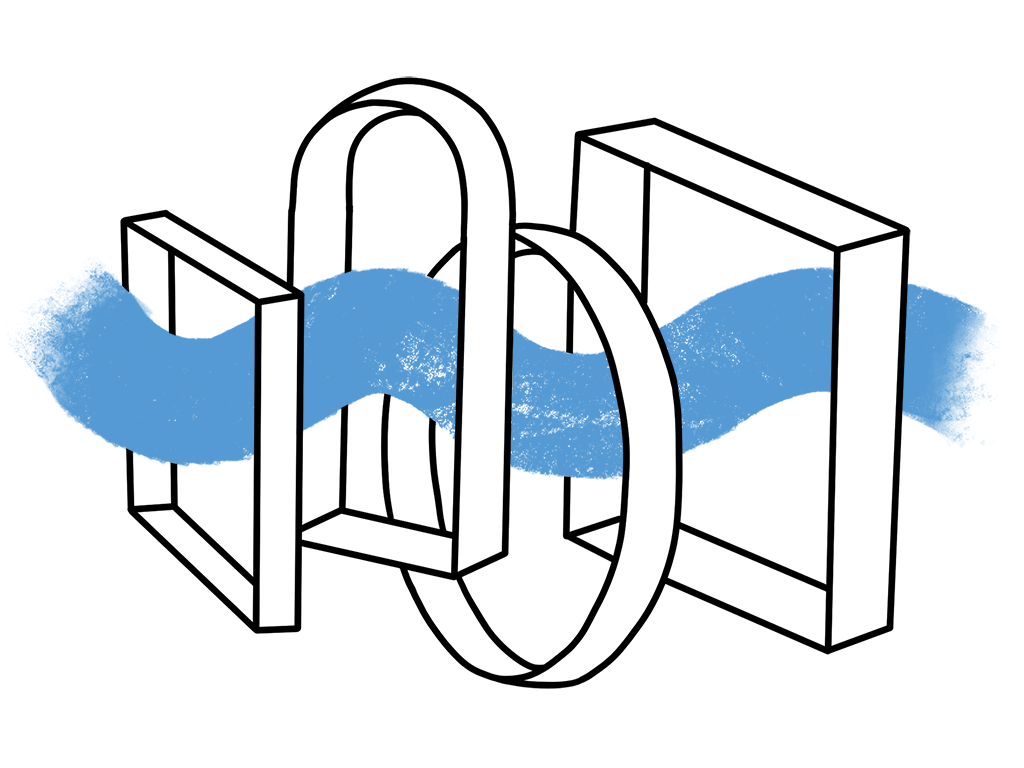
Machtverhältnisse prägen Forschungsthemen
Die an Hochschulen vermittelten Erkenntnisse präsentieren sich oft als neutral und objektiv. Doch Wissen ist immer situiert. Forschende agieren nicht als neutrale, austauschbare Akteur*innen. Sie sprechen als Individuen und aufgrund ihrer Berufsrolle immer aus einer bestimmten gesellschaftlichen Perspektive.
Worüber geforscht, geschrieben und gelehrt wird, welche Wissensbestände als relevant erachtet werden, hängt stark von den herrschenden Machtverhältnissen ab.
Die fehlende Perspektive der globalen Mehrheit
Die aktuell dominanten Methoden und theoretischen Paradigmen in den Sozialwissenschaften sind auf Westeuropa und Nordamerika fokussiert (Eurozentrismus). Sie spiegeln in ihren Themensetzungen den Erfahrungsraum wider, den die ca. 800 Millionen Menschen in der EU und Nordamerika teilen. Weder in der Forschung noch Theoriebildung werden die Fragen der restlichen 90 Prozent der Weltbevölkerung berücksichtigt.
Eine Öffnung gegenüber anderen Wissenschaftsmodellen geschieht nur zögerlich. Zudem sind Datengrundlagen oft einseitig. So zeigt zum Beispiel der Gender-Data-Gap an Beispielen der technischen und medizinischen Forschung deutlich, wie der Verzicht auf die Perspektive von Frauen* zu mangelhaften Daten führt. Auch das Wissen nicht-westlicher und nicht-weisser Forscher*innen wird häufig marginalisiert und ignoriert.
Vielfältige wissenschaftliche Perspektiven
Eine sensible Quellen- und Literaturauswahl hilft zu verstehen, dass es immer verschiedene Perspektiven auf einen Sachverhalt gibt. Diese müssen nicht in einem hierarchischen Verhältnis zueinanderstehen.
Weiterführende Materialien
Webseiten
- BRIDGES, Feministische und antirassistische Praktiken an europäischen Hochschulen
- Fachdidaktik und Diversität – Curriculare Verankerung in der Lehrpersonenbildung, PH Luzern
- GEMS-Plattform, Gender und Medizin. Ein Netzwerk der Schweizer Universitäten
- Gender Curricula, Koordinations- und Forschungsstelle Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW
- Youtube-Video: «Why is my curriculum white?», University College London
Literatur
- Castro Varela, María do Mar (2021). Kontrapunktische Bildung, Critical Literacy und die Kunst des Verlernens.In: Dankwa, Serena O., Filep, Sarah-Meh, Klingovsky, Ulla, Pfründer, Georges (Hrsg.). Bildung. Macht. Diversität. (S. 111-130). Bielefeld: transcript. https://doi.org/10.14361/9783839458266-008
- Haraway, Donna (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. (S. 575-99). Feminist Studies 14, Nr. 3. https://doi.org/10.2307/3178066
- Malik, Mariam (2022). Wer lernt (was) auf wessen Kosten? Positionierungen und Bedürfnisse in Lernräumen – von den Erfahrungen von Schwarzen Studierenden und Studierenden of Color an der Hochschule. In: Akbaba, Yaliz et al. (Hrsg.). Lehren und Lernen in Differenzverhältnissen: Interdisziplinäre und Intersektionale Betrachtungen. (S. 25-44). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-37328-3_2