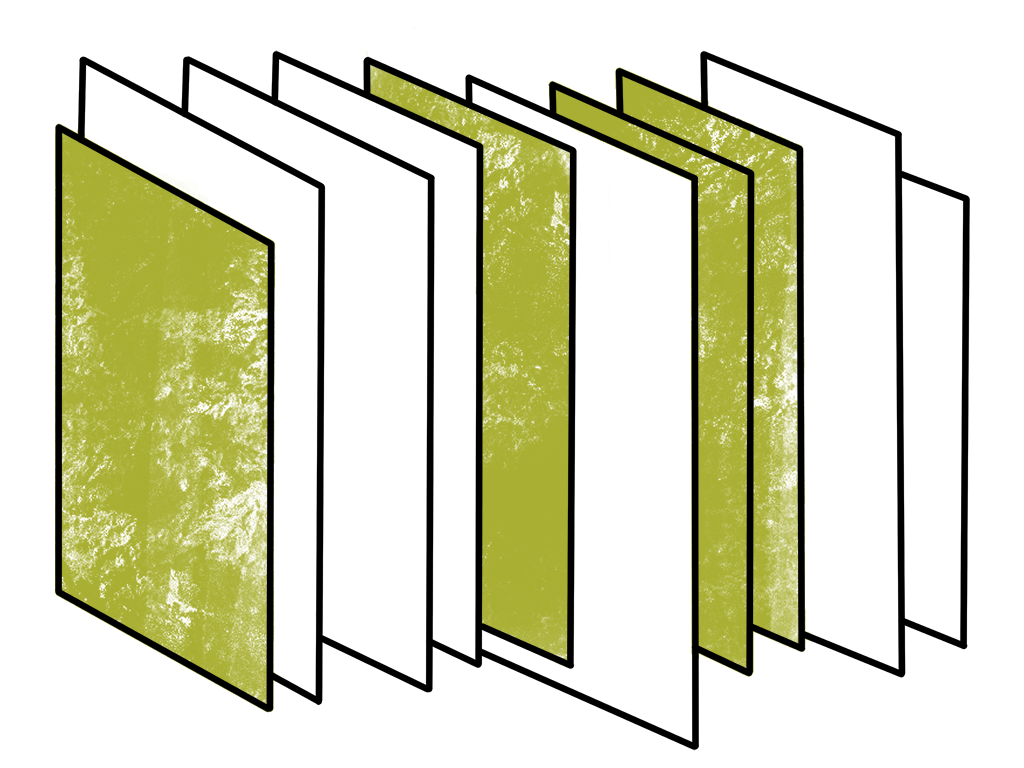Studierende – Inhalt
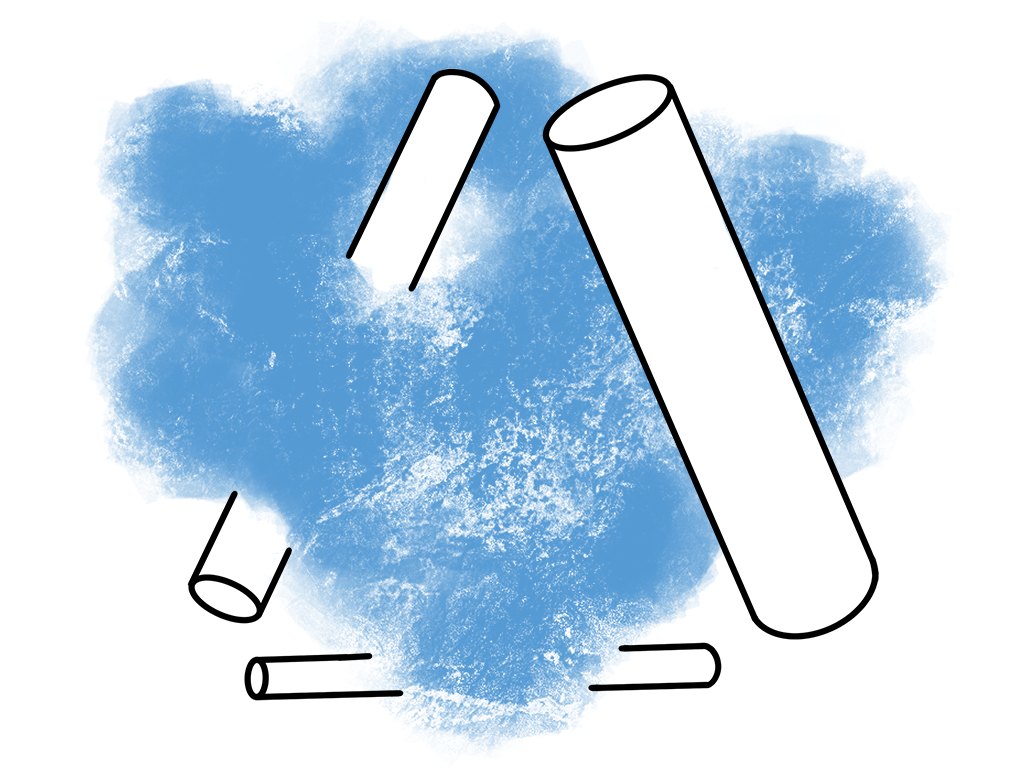
Die Beziehungsebene ‘Studierende – Inhalt’ bildet eine der drei Seiten des didaktischen Dreiecks. Hier geht es vor allem um Aspekte und Prozesse, bei denen die Studieninhalte in Wechselwirkung mit den Studierenden ihre Bedeutung und Relevanz entfalten. Die Dozierenden als dieser Ebene entgegengesetzter Eckpunkt des Dreiecks sind dabei stets mitzudenken.
Lehrinhalte als Teil der eigenen Lebenswelt begreifen
Ein zentrales Anliegen ist es, dass Studierende den Lehrinhalt nicht als fremdes Element, sondern als Teil ihrer eigenen Lebenswelt begreifen. Indem sie Selbst- und Weltverhältnisse in den Lernprozess einbeziehen, können sie den Stoff persönlicher und relevanter gestalten.
Eine solche Auseinandersetzung ermöglicht es den Studierenden, den Lehrinhalt kritisch zu hinterfragen und eigene Deutungen zu entwickeln. Kritisches Denken als bedeutsames Element von Hochschullehre macht auch mit Blick auf die Zukunft Sinn. Wollen wir Absolvent*innen, die die Zukunft aktiv mitgestalten und dabei weiterdenken können, dann geht es darum, für das noch Ungedachte einen Raum zu eröffnen.
Begleitung individueller Aneignungsprozesse
In diesem Zusammenhang nimmt die Rolle der Dozierenden eine besondere Stellung ein. Statt in erster Linie Wissen zu vermitteln, begleiten sie die Lernprozesse der Studierenden und unterstützen diese darin, sich mit eigenen Beiträgen in den gemeinsamen Lernraum einzubringen (siehe auch ‘Involvieren’ im Bereich ‘Praxis_Stimmen’). Das Ziel ist, dass die Studierenden langfristig in der Lage sind, selbstständig und kritisch zu denken und sich neues Wissen anzueignen.
Die Lernenden sollen selbst die Gelegenheit haben, aus dem Lerngegenstand Lesarten abzuleiten, diesem also selbst eine bestimmte Bedeutung, eine bestimmte Ordnung zu geben. Eine Auswahl an verschiedenen Vertiefungsthemen oder Formen von Leistungsnachweisen sind ein Beispiel dafür, wie die inhaltliche Auseinandersetzung in diesem Sinne bedürfnisorientiert gestaltet werden kann.
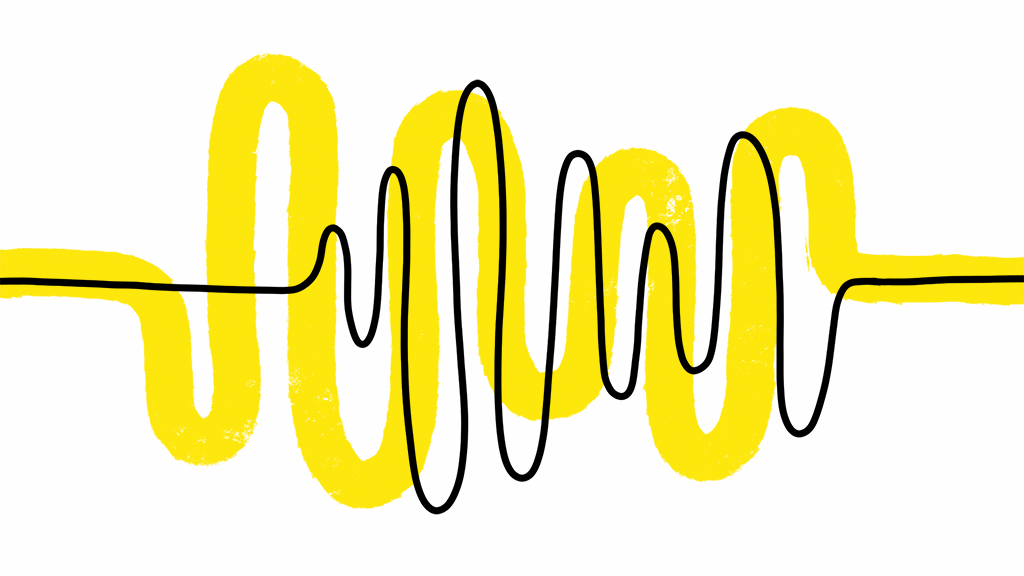
«Ich hab das relativ offen gelassen. Ich habe gesagt, dass es drei Formen von Leistungsnachweisen gibt. Eine ist, zwei kreative Texte zu schreiben. Eine ist, eine Sitzungsleitung und Sitzungsgestaltung zu übernehmen. Und eine ist, ein wissenschaftliches Essay zu schreiben. Einerseits, weil Leute unterschiedliche Bedürfnisse haben, aber ich glaube, es ist auch eine Frage von, ‘was wollen sie lernen’? Gerade bei der Sitzungsgestaltung oder wenn eine mögliche Form war, einen Input zu machen, habe ich auch immer gesagt, gerade Leuten, die schüchtern sind, die vielleicht Mühe haben oder zögerlich sind, Raum einzunehmen oder sich irgendwie melden, zu sprechen, dass sie diese Gelegenheit auch nutzen sollen, um das zu üben. Es gibt nur Pass und Fail und es soll ein fehlerfreundlicher, lernfreundlicher Raum sein. Ich finde das sehr wichtig, da auch verschiedene Möglichkeiten des Lernens und des eigenen sich Entwickelns anzubieten. Das wurde auch immer wieder genutzt. Ich finde es wichtig, irgendwie Konzepte zu verstehen, Mechanismen zu verstehen, da präzise zu sein, differenziert zu sein. Aber ich finde es auch sehr wichtig, darüber hinaus zu denken. Und das kann wissenschaftlich sein, aber ich denke, es gibt unterschiedliche Formen, die da Unterschiedliches ermöglichen. Und das kann auch in unterschiedlichen Leistungsnachweisen der Fall sein.»
Werden Diskriminierungen in der Lehre thematisiert, sollten Betroffene selbstbestimmt mit den entsprechenden Aspekten und ihrer Verhandlung im Lehr-Lernraum umgehen können. Dazu gehört, Möglichkeiten zu haben, sich der Situation gegebenenfalls zu entziehen. Gleichzeitig können Studierende auch selbst relevante Inhalte in die Lehre einbringen. Ihre biografischen Ressourcen, Sprach- und Erfahrungshintergründe und spezifische Kenntnisse zu Macht- und Differenzverhältnissen kann für die Lehre inhaltlich sehr bereichernd sein.
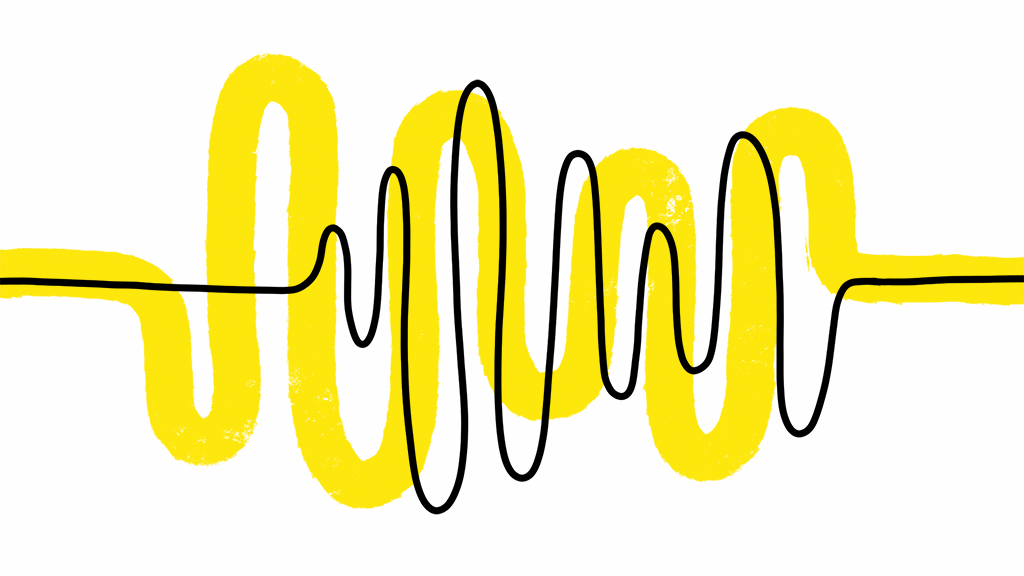
“Triggerwarnungen! Also meine Erfahrung ist gerade bei Sozialarbeit, Sozialpolitik, aber auch Kinder-, Jugend-, Familienstudien, dass es manchmal Themen sind, die heftig sind: Gewalt, psychische Störungen, Tod, Verlust. Und ich fände es wirklich so wichtig, dass vielleicht in der Kurzbeschreibung, aber auch vor der jeweiligen Vorlesung, nochmals eine Triggerwarnung kommt. Auch bei Suizidalität und all diesen Themen. Oder, dass es auch die Möglichkeit geben würde, dass man sich rausnehmen darf. Also, dass aktiv gesagt wird, heute besprechen wir das. Oder, dass es in der Kurzbeschreibung steht, damit falls es beispielsweise Betroffene gibt, sich diese auch rausnehmen können, ohne eine Absenz zu erhalten. Ich fände das sehr wichtig. Und verständliche Kurzbeschreibungen. Ich habe gerade dieses Semester mit einer Freundin, die an der Fachhochschule studiert, Kursbeschreibungen hin- und hergeschickt, weil wir uns beide dachten, dass sich die Dozierenden mit schwieriger Sprache zu übertreffen versuchen. Wir waren wirklich so: ‘Oh, was wollen die hier? Was ist der Inhalt dieses Kurses?’ Also, ja, manchmal kommt man gar nicht draus.”
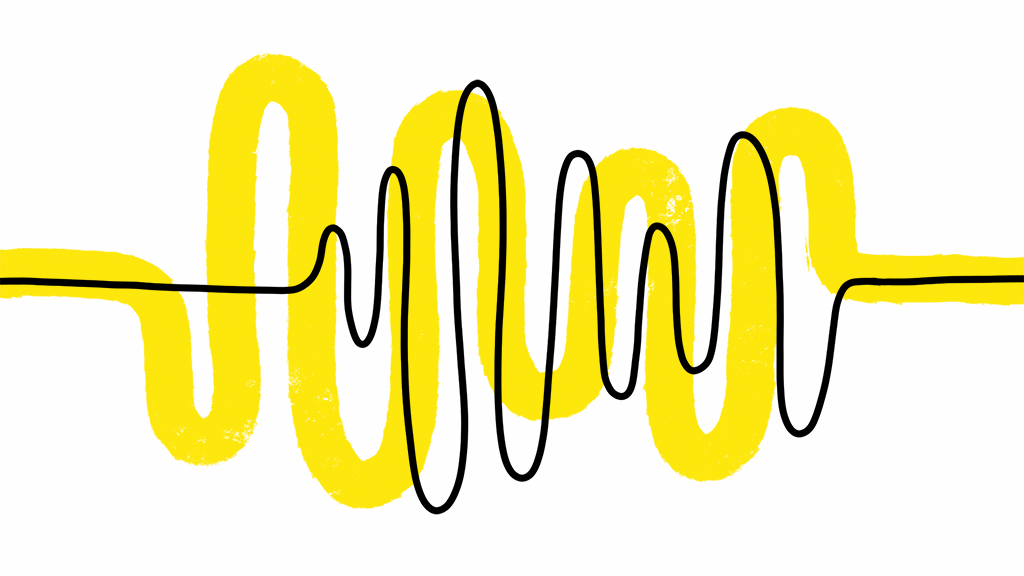
«Ich finde so zwei Aspekte (wichtig): Einerseits eben ‘einfache Sprache’. Aber andererseits auch das Wording, also wie benennt man Sachen, welche Ausdrücke verwendet man, sind sie verletzend, gibt es Triggerwarnungen? Ich finde, dass das an der Uni irgendwie noch gar nicht angekommen ist. Und bei den Dozierenden habe ich an der Universität die Erfahrung gemacht, dass diese Rückmeldungen auch noch nicht wirklich Platz haben oder auch nicht abgeholt werden. An der Fachhochschule waren wir viel mehr im Austausch…ich hole schnell aus. Ein Beispiel: Meine Familie sind Imazighen, das ist die indigene Bevölkerung aus Tunesien. In Europa benennt man sie meistens als ‘Berber’, aber für uns ist das eigentlich eine Beleidigung, es hat viel mit Kolonialisation zu tun, ‘Berber’ bedeutet eigentlich Menschen, die keine Sprache haben. Und Imazighen heisst freie Menschen, was viel ermächtigender ist. Ich habe das dann an der Fachhochschule mal angesprochen, dass das so wäre und dass mir das wichtig ist und daraufhin haben sie alle Unterlagen etc. angepasst, hatten sich auch entschuldigt und es wurde sofort umgesetzt. Das war für mich auch empowering, so zu merken, ich kann etwas ansprechen und ich werde als Einzelperson ernst genommen. Ja, das fand ich sehr schön.”
Herausforderungen auf der Ebene ‘Studierende – Inhalt’
- Heterogenität der Studierenden: Unterschiedliche Vorkenntnisse, Lernstile, Betroffenheiten von Diskriminierungen, Interessen, Haltungen und Lerntempi erfordern eine flexible und individuelle Gestaltung der Lehre.
- Motivation: Die Aufrechterhaltung einer hohen Motivation ist eine zentrale Herausforderung. Externe Faktoren, Diskriminierungen im Lehr- und Lernraum, und persönliche Umstände können die Lernbereitschaft der Studierenden mitbeeinflussen.
- Selbstregulierung: Nicht alle Studierenden sind gleichermassen in der Lage, ihren Lernprozess selbstständig zu organisieren und zu steuern.
- Bedeutungskonstruktion: Es ist nicht immer einfach, den Lehrinhalt für alle Studierenden bedeutsam zu machen. Hier kann eine gezielte Begleitung durch die Dozierenden erforderlich sein.
Reflexionsfragen
- Wie kann ich Studierenden ermöglichen, die Lehrinhalte in Beziehung zu sich selbst zu setzen? Was sollte ich dabei hinsichtlich der Heterogenität der Studierenden mitdenken und praktisch berücksichtigen?
- Wie kann ich in meiner Lehre kritisches Denken fördern?
- Inwiefern kann ich sicherstellen, dass Studierende, die Diskriminierungserfahrungen machen, sich im Lehr-Lernraum sicher und unterstützt fühlen?
- Wie kann ich relevante Beiträge von Studierenden effektiv in meine Lehre integrieren und fördern?
Weiterführende Materialien
- Danz, Simone (2023). Ent-hinderung. Ein Leitfaden. Beltz Juventa (Link zum Verlag)
- diskrit. Diskriminierungskritische Perspektiven an der Schnittstelle Bildung/Kunst, Kunsthochschule Mainz
- «Es reden immer die Gleichen? 17 Anregungen für Lehrende» von Melanie Bittner (2019), Toolbox Gender und Diversity in der Lehre, Freie Universität Berlin
- Steyn, Melissa (2015). Critical Diversity Literacy: Essentials for the twenty-first century. In: Vertovec, Steven (Hrsg.). Routledge International Handbook of Diversity Studies. (S.379-389). London/New York: Routledge. (Link ResearchGate)
- Sprachmächtig – Glossar gegen Rassismus, Netzwerk bla*sh
- swissuniability, Anlaufstellen für Chancengleichheit und Inklusion an Hochschulen
Content Notes und Triggerwarnungen
- An Introduction to Content Notes and Trigger Warnings, University of Michigan
- Content Notes, Centre for Educational Excellence
- Trigger Warnings, University of Toronto
- Why use content notes? Cambridge Center for Teaching and Learning