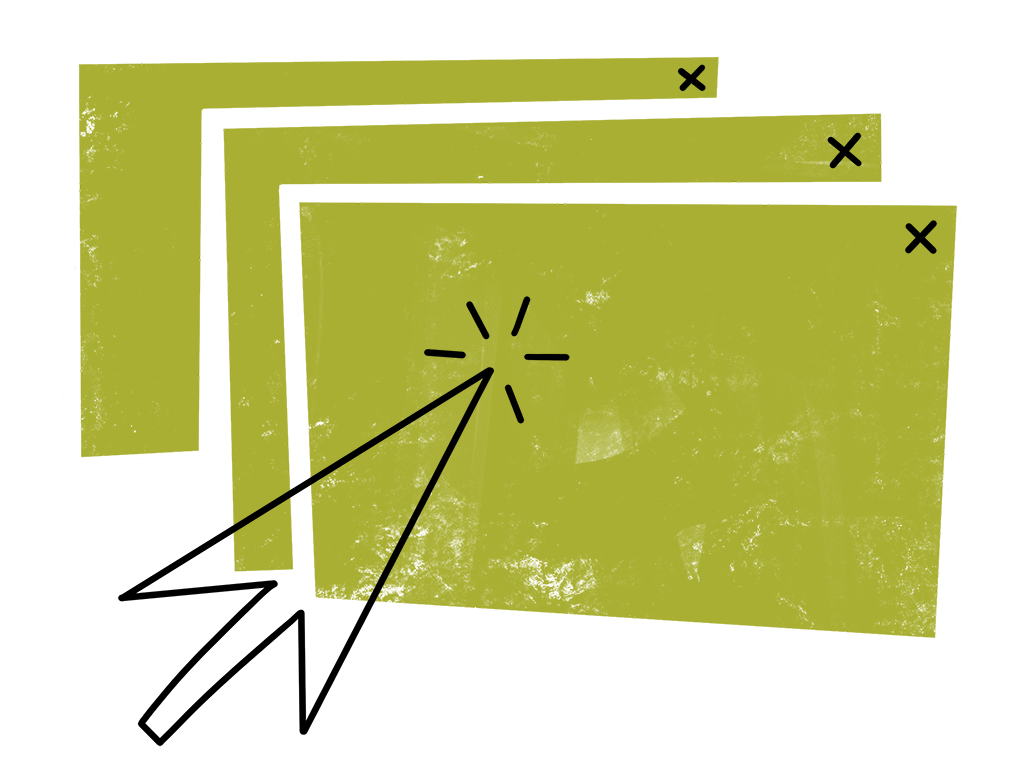Praxis_Stimmen
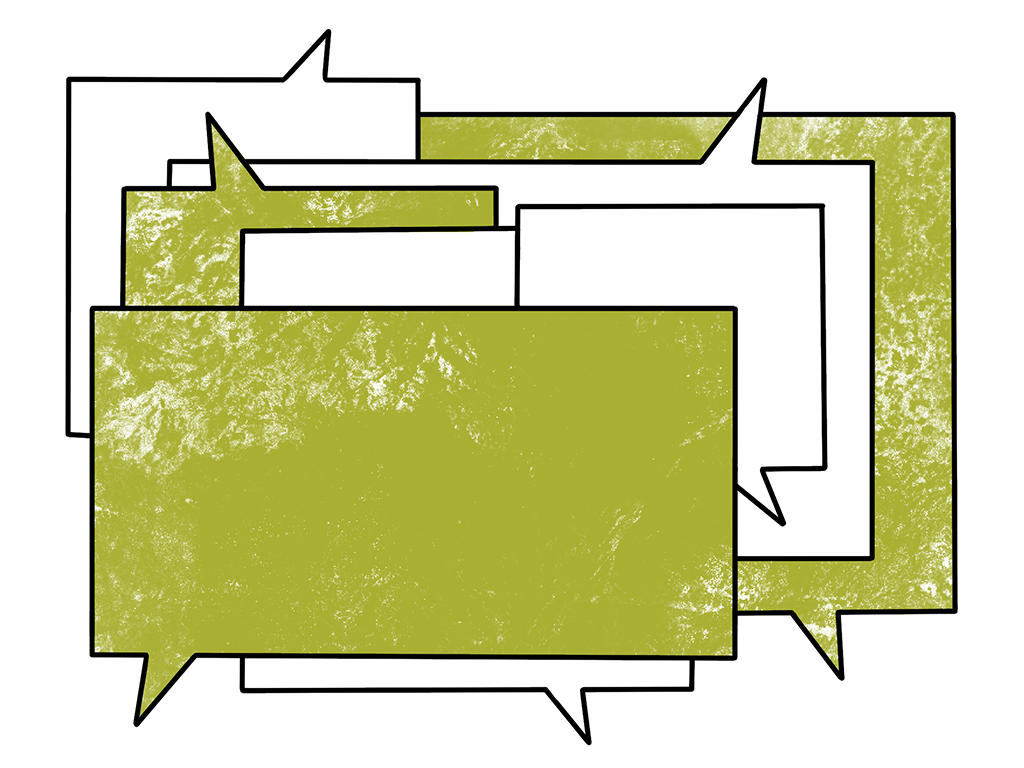
Die hier zur Verfügung gestellte lose Sammlung an Praxis_Stimmen gibt aus unterschiedlichen Perspektiven einen Einblick in die Umsetzung differenzsensibler Lehre. Sie resultiert aus Interviews mit Studierenden und Dozierenden, welche als Grundlage für die Enwicklung dieser Website dienten.
Einzelne aus dem Interview-Material ausgewählte Passagen machen Erwartungen an gute, differenzsensible Lehre hörbar und zeigen in Form von Beispielen und Erfahrungen, wie sich der Anspruch differenzsensibler Lehre in die Praxis übersetzt und wo Herausforderungen bestehen.
Die Sammlung besteht aus Text-Audio-Kombinationen: Vorgelagerte Texte kontextualisieren ausgewählte Original-Töne aus den Interviews, indem sie Verbindungen zu einem übergeordneten Thema und zu den theoretischen Grundlagen in der Rubrik ‘Dimensionen’ herstellen. Die Texte erschliessen sich daher nur in Verbindung mit den Audiospuren.
Je nach Disziplin macht ein Studium das Lesen und das Formulieren von Texten erforderlich. Aufgrund hoher Abstraktion ist dabei meist ein akademischer oder wissenschaftlicher Sprachduktus vorrangig, der sich in Grammatik und Wortwahl niederschlägt. Dieser Duktus bildet häufig eine hohe Hürde und kann sehr frustrierend sein – zumal er als Kennzeichen für Wissenschaftlichkeit gilt. Dies kann dazu führen, dass leicht(er) verständliche und anschauliche Formulierungen als zu wenig wissenschaftlich ausgelegt werden.
Das Bemühen um Verständlichkeit über die Fach-Community hinaus ist gerade an deutschsprachigen Universitäten noch wenig vorhanden. Relativ einfach kann dem begegnet werden, indem wiederkehrende Vorlesungen in einfache Sprache zum Nachlesen übersetzt werden. Dies würde es auch ermöglichen, die Dokumente per Vorlesefunktion auditiv zugänglich zu machen.
Der Bereich ‘mit Sprache ein- oder ausschliessen’ geht näher auf die Themen ‘einfache’ und ‘leichte Sprache’ ein.
«An der Universität höre ich bei jeder Arbeit, dass mein Ausdruck zu wenig wissenschaftlich ist. Und ich denke mir, ‘ja, aber dafür verstehen es auch meine Eltern’.»Studentin, Universität
«Ich finde, die Universität macht es einem manchmal sehr schwierig mit der Sprache, weil es oft ein Wortschatz, ein Jargon, aber auch eine Grammatik ist, die sehr ausschliessend sein kann, die man zehnmal lesen muss. Wenn man die Vorlesefunktion benötigt, sind die Sätze so verschachtelt, dass man nicht nachkommt. An der Fachhochschule habe ich sehr geschätzt, dass oft ‘einfache Sprache’ verwendet wurde und wenn man zum Beispiel eine Arbeit geschrieben hat, wurde gesagt, die Arbeit sei dann gut, wenn alle sie verstehen. Und das war für mich sehr prägend und jetzt an der Universität höre ich bei jeder Arbeit, dass mein Ausdruck zu wenig wissenschaftlich sei und ich denke mir immer: ‘ja, aber dafür verstehen es auch meine Eltern’. Deshalb ist für mich Sprache sehr wichtig und es kann auch sehr frustrierend sein, wenn man nicht versteht.»
Freies Sprechen vor einer Gruppe verlangt Selbstvertrauen und ist für viele Studierende ungewohnt oder gar angstbesetzt (Sprechangst). Dozierende können aktiv für eine angstfreie Atmosphäre sorgen, indem sie (auch eigene) sprachliche Äusserungen als Möglichkeit sehen, sie aus verschiedenen Richtungen zu befragen oder gemeinsam zu durchdenken. In einem solchen diskursiven Klima kann auch widersprochen werden. Widerstände dürfen sich zeigen und werden für die Vertiefung einer Thematik fruchtbar gemacht. Zu einem solchen Klima trägt bei, wenn Studierende Fehler machen können, ohne eine Blossstellung befürchten zu müssen.
Auf der Plattform ‚Tricky Moments‚ wird fehlerfreundliches Agieren in der Lehre vertiefend dargestellt.
«…ein Klima zu schaffen, in dem die Studierenden sich getrauen, etwas zu sagen.»Dozent, Universität
«Es scheint mir auch wichtig zu sein, zu schauen, dass es den Studierenden irgendwie wohl ist, damit sie sich beteiligen können. Das ist bei grösseren Kursen fast schwieriger, weil da die Hemmschwelle relativ gross ist. Und darauf basierend fände ich eine gute Lehre zum Beispiel eine Lehre, die es schafft, ein Klima zu schaffen, in dem sich die Studierenden getrauen, etwas zu sagen, ohne dass sie Angst haben, dass das irgendwie dann abgekanzelt wird. Also auch ein Klima, wo sie auch mal was Falsches sagen können. Und wo es hauptsächlich darum geht, mitzudenken und sich dann gemeinsam zu überlegen, stimmt das jetzt oder was lässt sich dazu sagen?»
Differenzsensible Lehre ist verknüpft mit dem Streben nach mehr Zugänglichkeit – sowohl zur Infrastruktur als auch zu den Inhalten der Lehre. Beides geht auch eng einher mit der räumlichen Situation und den Settings darin. Wenn zur Bearbeitung eines Themas beispielsweise die Beziehungsebene wichtig ist, eignet sich ein Hörsaal aufgrund des fehlenden Blickkontakts vielleicht eher weniger.
Die eigene Aufmerksamkeit als Dozierende*r kann dahingehend geübt werden, dass immer wieder aufs Neue geprüft wird, was der Zugänglichkeit zu Räumen und Inhalten entgegensteht und was sie unterstützt. Folgende relationale Aspekte können dabei eine Rolle spielen:
- Wie ist die räumliche Situation der Lehrveranstaltung beschaffen und unterstützt sie die Vermittlung meiner Inhalte?
- Haben alle einen freien Zugang zum Raum und gute Sicht?
- Wie ist die Akustik im Raum?
- Wie fühlt sich der Raum an: kalt, warm, einschüchternd, einladend …?
- Wie ist die Sitzanordnung gestaltet: frontal nach vorne ausgerichtet, im Kreis, gibt es Tischinseln etc.?
Es gibt nicht ‘das’ differenzsensible Lehr-Lern-Setting oder ‘die’ differenzsensible Methode. Wichtig mitzudenken ist vielmehr, dass jede Lehr-Lernform spezifische Voraussetzungen impliziert und damit für manche Studierende mehr und für andere weniger oder gar nicht anschlussfähig ist. Die eingesetzten Formen müssen daraufhin immer wieder neu angeschaut und ggf. angepasst oder austariert werden.
Unter ‘räumlich-technische Infrastruktur’ finden sich weitere Informationen zum Thema.
«… was mir auch nicht bewusst war, ist, dass wenn Studierende zu mir sprechen, sehen sie ja nicht, wie die Gesichter hinter ihnen sind und wie andere Personen reagieren.»Dozentin, Universität
«Bei der letzten Veranstaltung war der Raum, den ich bekommen habe, zu klein und wir sind ausgewichen in einen Hörsaal. Da war dann die Rückmeldung, dass der Hörsaal schon nicht so cool sei. Was mir nicht bewusst war, ist, dass wenn Studierende zu mir sprechen, sehen sie ja nicht, wie die Gesichter hinter ihnen sind und wie andere Personen reagieren und das fanden sie sehr verunsichernd. Ich habe ja alle gesehen. Das hat mir irgendwie sehr eingeleuchtet und dann habe ich uns einen anderen Raum besorgt.»
Für die Realisierung einer differenzsensiblen Lehre ist es zentral, dass sich Dozierende aktiv, kritisch und bewusst sowohl mit der Herkunft als auch mit den Implikationen und narrativen Funktionen von Begriffen und Sprachbildern auseinanderzusetzen. Entgegen des vielfach geäusserten Vorbehalts geht es dabei nicht um eine Art sprachlicher Aufsicht oder Reglementierung. Es geht um ein Bewusstsein für die Wirkungsdimensionen von Sprache ausserhalb individueller Aussageabsichten.
So berichtet eine Bewegung und Sport-Dozentin, dass es bspw. einen Unterschied macht, ob sie in ihrem Unterricht mit Metaphern von ‘Urwald’ oder von ‘Dschungel’ arbeitet. Denn im Unterschied zur Bezeichnung ‘Urwald’ transportiert der im alltäglichen Sprachgebrauch gängige Begriff ‘Dschungel’ auch Assoziationen, die von europäisch-kolonialer Expansion und Überlegenheitsdenken herrühren (insbesondere in Verbindung mit dem Gegenbegriff ‘Zivilisation’). Diese Bedeutungsschichten müssen nicht explizit ‘gemeint’ sein. Aufgrund ihrer diskursiven Verbreitung in Bildern, Objekten, Erzählungen und Texten werden sie mit der Sprache erlernt, so dass die blosse Nennung reicht, um die enthaltenen Assoziationen und Konnotationen – und die damit einhergehenden Hierarchisierungen – immer wieder neu zu aktualisieren.
Weiterführende Links dazu:
- Arndt, Susan (2022): Rassistisches Erbe. Wie wir mit der kolonialen Vergangenheit unserer Sprache umgehen. Berlin: Duden Verlag. (Link zum Verlag)
- Begriffe über Behinderung von A bis Z, Leidmedien.de
«Und dann tauchen so Aspekte auf wie ‘vom Dschungel zurück in die Zivilisation’ oder irgendetwas erforschen und dabei in den ‘Dschungel’ gehen oder auf eine ‘Südseeinsel’.»Dozentin, Pädagogische Hochschule
«Und dann geht es natürlich auch um Sprache verbunden mit Geschichten, die erzählt werden. Und das ist ja gerade auch in der Lehrpersonenbildung relevant, wo es immer wieder darum geht, mit Metaphern zu arbeiten, um Kindern den Inhalt zugänglich zu machen. Es geht darum, Geschichten zu erzählen, die dann in Bewegung umgesetzt werden und so. Und da ist es mir wichtig, auf rassisierende, ethnisierende Narrationen oder auf koloniale Narrationen zu verweisen. Was halt immer auftaucht im Kontext von Bewegung und Sport, sind ‘Dschungelerzählungen’. Und dann tauchen so Aspekte auf wie ‘vom Dschungel zurück in die Zivilisation’ oder irgendetwas erforschen und dabei in den ‘Dschungel’ gehen oder auf eine ‘Südseeinsel’ oder so was in der Richtung. Und da merke ich, dass für viele Studierende die Dimension dieser Narration überhaupt nicht klar ist. Und es gibt unheimliche Widerstände dagegen, sich damit auch zu konfrontieren, weil es ja auch mit so einer kindlichen Harmlosigkeit verbunden wird. Weil natürlich sind Elefanten und Tiger interessanter als Eichhörnchen und Reh oder so. Und trotzdem glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, sich bewusst zu sein, was hinter diesen Narrationen steht und wer diese Narrationen wieder aufgreift. Und wo tauchen sie dann eben nicht auf in anderen Bereichen? Und da auch – und das ist glaube ich etwas, was mir auch wichtig ist in meinen eigenen Arbeiten, wo es mir um differenzbewusste Lehre oder eben auch Hochschullehre geht – mit Blick auf die Sportdidaktik, mit Blick auf Vermittlungen von sportbezogenen Inhalten wirklich deutlich zu machen, dass wir da sehr viel lernen und sehr viel verlernen müssen. Es ist ja durchaus voraussetzungsvoll, bestimmte Motive einfach zu erkennen. Und wenn ich die in der Lehre nur ganz kurz anspreche, habe ich festgestellt, dass es ganz oft einfach zu einer Art Shutdown führt. Also Studierende sitzen da und sagen nichts mehr.»
Aufbau und Gestaltung einer guten Beziehung zwischen Lehrenden und Lernenden ist für Bildungsprozesse unabdingbar. Was allerdings Lehrende aktiv dafür tun können, bleibt im Bereich der Hochschullehre häufig ihnen selbst überlassen. Denn im Unterschied zum Schulfeld kommt diese Frage sowohl in der hochschuldidaktischen Reflexion als auch in der universitären Aus- und Weiterbildung kaum vor.
Für Studierende ist es aber im Sinne einer guten Lehre elementar, als Person gesehen zu werden. Erlebt wird dies, wenn Dozierende bspw. auf die inhaltlichen Interessen von Studierenden eingehen und den Ablauf des geplanten Seminarprogramms anpassen, anstatt starr daran festzuhalten ohne die Studierenden einzubeziehen.
Je nach Grösse und disziplinärer Ausrichtung einer Lehrveranstaltung fordert dieser Anspruch unterschiedlich heraus. In Seminaren und Modulen können Dozierende in einen Dialog mit der Gruppe gehen. Im Fall von frontalen Grosslehrveranstaltungen wie Vorlesungen sind die Bedingungen andere und der Beziehungsaspekt verlagert sich etwas. Dennoch können auch hier durch rhetorische Mittel (anschauliche Beispiele, Fragen, Gedankenexperimente) Studierende adressiert und einbezogen werden. Analoge Möglichkeiten der Aktivierung (bspw. Murmelgruppen) gibt es auch in Vorlesungen. Zudem können Rückmeldungen oder Fragen durch digitale Tools eingeholt werden.
«… gute Lehre hat für mich mit Inhalten und Beziehung zu tun.»Studentin, Pädagogische Hochschule
«Eine gute Lehre hat für mich mit Inhalten und Beziehung zu tun. Einerseits sehr studierendenorientierte Inhalte, am Interesse oder am Arbeitsalltag entlang, und Beziehung insofern, dass ich spüre, dass mein Gegenüber auf mich eingeht und auch da ist für Fragen und nicht nur das geplante Programm durchzieht während des Semesters. Mir fällt eine Situation ein von einer mitstudierenden Person, die chronisch krank ist und die dozierende Person einfach akzeptiert hat, dass diese Person nicht an jedem Seminar teilnehmen kann und auch klar gegenüber den anderen Studierenden kommuniziert hat, dass es einen Grund hat und das es okay ist und dass darüber nicht getuschelt werden muss, wieso diese Person wieder nicht da ist oder wie auch immer, sondern dass es abgesprochen und okay so sei. Und ich fand das wichtig, einfach zu sagen, wie das gehandhabt wird – auch ohne Nachteilsausgleich oder sonstige Bescheinigung, sondern einfach menschlich.»
Universitäten und Hochschulen überlassen es häufig den einzelnen Dozierenden, ob und welche Regelungen sie bezüglich der Anrede von Studierenden treffen und anwenden.
Grundsätzlich gilt, dass die bewusste Anrede mit dem falschen Namen (‘Deadname’) oder dem falschen Pronomen verletzend und diskriminierend ist und das Selbstbestimmungsrecht der so angesprochenen Person missachtet. Jede Person soll so angesprochen und benannt werden, wie sie es wünscht. Wenn Geschlechtsidentität, präferierte Pronomen oder Selbstbezeichnung einer Person nicht bekannt sind, können auch Vornamen und Nachnamen statt ‘Frau’ oder ‘Herr’ verwendet werden – dies sowohl im direkten Kontakt in der Lehre als auch in der digitalen Kommunikation per E-Mail.
«Es wird sehr stark auch den Dozierenden überlassen, inwiefern sie aktiv sind.»Dozent, Universität
«Also wenn ich da von ‘wir’ spreche, dann sind das die Kurse, in denen ich beteiligt bin. Das ist nicht eine offizielle Politik meiner Universität oder meines Bereichs an der Universität. Also diesbezüglich, ist es so, dass da sehr wenig passiert. Also es wird sehr stark auch den Dozierenden überlassen, inwiefern sie aktiv sind oder was sie in diesem Bereich machen und was nicht. Das hat wahrscheinlich auch Vorteile, weil ich denke, wenn man sich da einigen müsste, wäre es wahrscheinlich nicht eine Lösung, die ich besonders toll finden würde. Wir haben bei uns im Team eine relativ grosse Bandbreite von Lösungen. Zum Beispiel: Die Mehrheit versucht, binär gedacht geschlechtssensibel zu sein und auch das ist noch nicht bei allen angekommen. Dann gibt es (aber) auch andere, die versuchen (auch) nicht-binär geschlechtssensibel zu sein. im Ausdruck, aber auch zum Beispiel in der Ansprache. Ich habe damit begonnen, wenn ich mit Studierenden noch keinen grossen Kontakt hatte, die Mail so zu schreiben, dass ich einfach sage: ‘Guten Tag Vorname und Nachname’ und dann mal schauen, was passiert. Wenn man Studierende dann besser kennt und auch die Selbstbeschreibungen und Verortungen mitbekommt in Kursen, dann kann das dann auch mal zu ‘Guten Tag Frau Name’ wechseln. Aber das ist so ein Thema, das ich und einige, die bei uns arbeiten, versuche so zu lösen, aber vorgeschrieben ist da in dem Sinne nichts. Und wenn da ein Konsens bestehen müsste, dann wäre der wahrscheinlich an einem anderen Ort. Also, in dem Sinne ist das der Vorteil der Freiheit, man kann dann auch das machen, was man selbst als vernünftig anschaut in diesem Bereich.»
Differenzsensibel zu lehren, erfordert von den Dozierenden Aufmerksamkeit auch für eigene Vorannahmen und Zuschreibungen. Diese können sich in Momenten zeigen, in denen Handlungen und Äusserungen von Personen als störend oder irritierend wahrgenommen werden. Bei diesen Irritationsmomenten kann man reflektierend einhaken und sich fragen: Welche Bilder habe ich im Kopf von Studierenden, die in meine Veranstaltung kommen? Wie kommt es zu diesen Bildern? Wie und warum reagiere ich auf bestimmte Personen, auf bestimmte Körperlichkeiten, auf bestimmte Formen der Artikulation, auf bestimmte Sprachregister? Wie interpretiere ich aufgrund meiner Zuschreibungen deren Handlungen und Äusserungen?
Werden im Nachgang der Lehr-Lern-Situation die eigenen Irritationen und Empfindungen aufmerksam registriert und kritisch befragt, öffnet dies die Möglichkeit, internalisierte hierarchisierende Zuschreibungen zu unterbrechen. Dadurch öffnet sich neuer Spielraum für anders mögliche Deutungen des Gegenübers im Sinne eines ‘Verlernens’.
Weiterführende Literatur dazu ist etwa:
- Castro Varela, María do Mar (2021). Kontrapunktische Bildung, Critical Literacy und die Kunst des Verlernens.In: Dankwa, Serena O., Filep, Sarah-Meh, Klingovsky, Ulla, Pfründer, Georges (Hrsg.). Bildung. Macht. Diversität. (S. 111-130). Bielefeld: transcript. (open access)
- (Un-)Wissen. Verlernen als komplexer Lernprozess | migrazine
«Ich möchte mich von den Personen, die in meiner Lehre sind, immer wieder überraschen lassen können.»Dozentin, Pädagogische Hochschule
«Und ein zweiter Aspekt, der mir wichtig ist im Kontext von differenzsensibler oder diversitätsbewusster Lehre, ist wirklich zu reflektieren, welche Bilder ich eigentlich von Studierenden habe, die in den Seminaren auftauchen. Was passiert bei mir, wenn ich bestimmte Körper sehe, wenn ich bestimmte Personen sehe, wenn ich bestimmte Formen des sich Artikulierens höre oder so? Was schreibe ich den Personen zu? Und da habe ich schon so etliche Beobachtungen bei mir selber gemacht, bei denen ich dann immer wieder in so eine reflexive Distanz gehen muss und sagen muss, ‘Moment mal, was passiert da eigentlich gerade’? Und inwiefern reproduziere ich mit genau diesen Bildern und dieser Art, irgendwie Erwartungen an Studierende zu haben, eigentlich genau die Machtverhältnisse, denen ich entgegentreten möchte? Und das ist ja gerade auch eine Herausforderung. Es geht ja nicht darum, zu sagen, dass nur weil es mir ein Anliegen ist, ich dann automatisch alles richtig mache, sondern ganz im Gegenteil. Dann braucht es eben nochmal drei Schritte mehr, einfach zu sagen, nein, ich möchte das irgendwie hinkriegen. Und für mich läuft das so ein bisschen hinaus auf einen Satz: ‘Ich möchte mich von den Personen, die in meiner Lehre sind, immer wieder überraschen lassen. Und ich möchte meine eigenen Bilder kritisch hinterfragen, meine Zuschreibungen bewusst machen’.»
Der Einsatz von Bildern ist aus der Lehre kaum wegzudenken. Solche Bilder repräsentationskritisch zu hinterfragen und stereotype Illustrationen zu ersetzen, ist ein zentrales Mittel differenzsensibler Lehre. Denn durch eine bewusste Auswahl von Bildern können dominierende Normvorstellungen aufgebrochen und erweitert werden. Umgekehrt gilt, dass eine unbedachte Bildauswahl bestehende soziale Ungerechtigkeit, Gewaltverhältnisse und Diskriminierung fortschreiben und zementieren kann (bspw. wenn ein Foto eine Person zeigt, die auf eine andere Person im Rollstuhl herunterblickt). Differenzsensible Lehre vermeidet daher stereotype, hierarchisierende Bilddarstellungen, indem sie zum Beispiel:
- darauf achtet, dass die dargestellten Menschen die Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln,
- stereotypisierte Darstellungen sowie überholte Klischees wie zum Beispiel männliche/weisse Person in Leitungsfunktion und weibliche/Schwarze Person in unterstützender Funktion vermeidet,
- stattdessen bewusst mit solchen Stereotypisierungen bricht, indem Menschen möglichst in unklischierten Rollen und Funktionen dargestellt werden,
- darauf achtet, unterschiedliche Rollenverteilungen abzubilden und beispielsweise auch andere Familienkonstellationen zu zeigen, z. B. gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern,
- auf inklusive Bildunterschriften bzw. Bildbeschreibungen achtet,
- auch bei bildsprachlichen Elementen wie z. B. Emoticons auf Inklusivität berücksichtigt
Mehr Informationen zum Thema finden sich im Bereich ‘Bildsprache’.
«… und dann ist das naheliegendste, genau so ein Bild zu nehmen.»Dozentin, Pädagogische Hochschule
«So ein klassisches Beispiel ist, dass ich PowerPoint-Präsentationen für die Lehre vorbereite und noch ein bisschen veranschaulichen möchte, wie das in der Sporthalle aussehen kann und so weiter und so fort. Und wenn ich dann einfach ‘Kinder im Sportunterricht’ bei Google eingebe, dann finde ich zuerst zu 90 Prozent Bilder, auf denen lauter kleine, dünne, able-bodied, weisse Kiddies draufsind, die sich voller Freude bewegen. Und dann ist das Naheliegendste, genau so ein Bild zu nehmen, weil alle wissen, was gemeint ist. Und dann zu merken, dass ich genau dieses Bild nicht reproduzieren möchte, sondern ich irgendwie eine Vielfältigkeit abbilden möchte. Dann dauert so eine Recherche vielleicht 20 Minuten, vielleicht auch 25 Minuten oder vielleicht auch eine halbe Stunde. Und dann ist das vielleicht unbequem, weil ich nicht so viel Zeit habe, um die Lehre vorzubereiten. Und das sind so Aspekte, wo ich es als Herausforderung sehe, gerade auch, ich selber bin eine weisse Person, ich bin able-bodied, mein Körper wird irgendwie als Normkörper wahrgenommen. Und dass ich dann trotzdem sage, nein, diese Bequemlichkeit, die erlaube ich mir jetzt nicht, sondern, dass ich irgendwie eine andere Lehre gestalten möchte. Das ist zum Beispiel etwas, was mir wichtig ist. Und da auch mich zu beobachten. Was passiert bei mir… weil ich habe ja nicht mehr Zeit als andere Dozierende. Und trotzdem zu sagen, nein, das ist etwas, was mir wichtig ist.»
In der Hochschullehre gehört der korrekte Umgang mit Begriffen zum fachlichen Selbstverständnis. Und er ist Bestandteil des Selbstbilds der akademischen Sphäre als Ort der Vernunft, des Intellekts und der Gewaltlosigkeit. Beides – fachliches Selbstverständnis und das akademische Selbstbild – kann dazu führen, dass sich Dozierende durch kritische Hinweise und Rückmeldungen seitens Studierender in Frage gestellt sehen und sie diese nicht angemessen berücksichtigen. Ein offener Dialog zwischen Dozierenden und Studierenden kann diesbezügliche Missverständnisse klären und zu einem besseren Verständnis führen.
Insbesondere Bezeichnungen für Menschengruppen enthalten häufig eine hierarchisierende, abwertende Bedeutung und stellen aus postkolonialer Perspektive eine Form epistemischer Gewalt dar. Diese trägt zu gewaltförmigen gesellschaftlichen Verhältnissen bei und ist im Wissen selbst eingebettet, also in dessen Art der Entstehung, Ausformung, Organisationsform und Wirkmächtigkeit. Der Begriff epistemische Gewalt wurde von Gayatri Chakravorty Spivak in kritischer Anlehnung an die Arbeiten von Michel Foucault eingeführt.
Weiterführend:
- Brunner, Claudia: Epistemische Gewalt. Wissen und Herrschaft in der kolonialen Moderne. Bielefeld: transcript 2020. (Link zum Verlag)
- Spivak, Gayatri C.: Can the subaltern speak? In: N. Carry & L. Grossberg (Eds.), Marxism and the interpretation of culture (271-313). Urbana-Champaign, IL: University of Illinois Press 1988. (Link zum Verlag)
«In Europa benennt man sie meistens als ‚Berber‘, aber für uns ist es eigentlich eine Beleidigung, es hat viel mit Kolonisation zu tun.»Studentin, Universität
«Ich finde so zwei Aspekte (wichtig): Einerseits eben ‘einfache Sprache’. Aber andererseits auch das Wording, also wie benennt man Sachen, welche Ausdrücke verwendet man, sind sie verletzend, gibt es Triggerwarnungen? Ich finde, dass das an der Uni irgendwie noch gar nicht angekommen ist. Und bei den Dozierenden habe ich an der Universität die Erfahrung gemacht, dass diese Rückmeldungen auch noch nicht wirklich Platz haben oder auch nicht abgeholt werden. An der Fachhochschule waren wir viel mehr im Austausch…ich hole schnell aus. Ein Beispiel: Meine Familie sind Imazighen, das ist die indigene Bevölkerung aus Tunesien. In Europa benennt man sie meistens als ‘Berber’, aber für uns ist das eigentlich eine Beleidigung, es hat viel mit Kolonialisation zu tun, ‘Berber’ bedeutet eigentlich Menschen, die keine Sprache haben. Und Imazighen heisst freie Menschen, was viel ermächtigender ist. Ich habe das dann an der Fachhochschule mal angesprochen, dass das so wäre und dass mir das wichtig ist und daraufhin haben sie alle Unterlagen etc. angepasst, hatten sich auch entschuldigt und es wurde sofort umgesetzt. Das war für mich auch empowering, so zu merken, ich kann etwas ansprechen und ich werde als Einzelperson ernst genommen. Ja, das fand ich sehr schön.»
Im Zentrum der Darstellenden Künste und der Literatur steht oftmals die Auseinandersetzung mit Figuren, wie sie bspw. in schwierige Situationen, in Konflikte geraten oder wie sie unter Druck agieren. Als Publikum, als Spieler*in oder als Leser*in begleiten wir sie, versetzen uns in sie hinein oder distanzieren uns.
Figuren und ihre Geschichten interessieren uns auch dann, wenn unsere eigene Lebensrealität von derjenigen der Figuren weit entfernt ist. Die Auseinandersetzung mit dem (mehr oder weniger) fiktiven Personal in Dramatik und Literatur schafft Annäherung, vermag zu irritieren, kann das Eigene in Frage stellen und dadurch auch verändern.
Diese Praxis im Umgang mit Fiktion kann in der Lehre für die Beschäftigung mit Texten und Inhalten von Autor*innen fruchtbar gemacht werden, die von marginalisierter Position aus sprechen. Sie bietet Ansatzpunkte, um eine Sprache zu finden, die einen engagierten, emphatischen Zugang öffnen. Dazu gehört bspw. das Schreiben fiktiver Texte, die sich auf reale Lebenssituationen beziehen und die es nötig machen, sich in Personen und ihre Perspektive hineinzudenken.
«Sie haben das Gefühl, die Erfahrung ist ihnen zu fremd, wo ich Audre Lorde super finde, die sagt: Warum habt ihr kein Problem damit, Shakespeare zu unterrichten?»Dozentin, Universität
«Was ich auch von Studierenden gelernt habe, ist (folgendes). Wenn ich zum Beispiel Texte von schwarzen Autorinnen in meinem Seminarplan habe, ist es mir häufig begegnet, dass gerade weisse Schweizerinnen im Lektüre-Kommentar vorab geschrieben haben: ‘Ich, als weisse, privilegierte Schweizerin, weiss gar nicht, wie ich ein Lektüre-Kommentar über einen Text von einer Schwarzen Person schreiben soll’, weil sie Angst haben davor, weisse Suprematie zu zementieren, zu bestätigen. Und das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht. Weil einerseits zeigt es was Positives, es gibt ein Bewusstsein über Herrschaftsverhältnisse, Privilegien wieder, also wenn wir sie nicht wahrnehmen, wenn wir sie nicht sehen, wenn wir sie nicht benennen können, können wir sie auch nicht verändern. Und gleichzeitig hat es mich aber auch sehr irritiert oder traurig gemacht, weil schlussendlich distanzieren sie sich extrem von diesen Autorinnen – in dem Fall waren es Autorinnen. Sie haben das Gefühl, die Erfahrung ist ihnen zu fremd, wo ich irgendwie Audre Lorde super finde, die sagt, warum habt ihr kein Problem damit, Shakespeare zu unterrichten – also das war ihr Kontext – wo klar ist, es geht nicht um die Erfahrung, es geht um Herrschaft und es geht irgendwie darum, Angst zu haben, was Falsches zu sagen über Personen, die marginalisiert waren und sind. Aber ich denke, die Distanz ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir erreichen wollen. Ich denke, es braucht eigentlich einen empathischen, engagierten, involvierten Zugang und ich denke auch, wir nehmen die Autorinnen nicht ernst, wenn wir uns nicht kritisch und differenziert mit diesen Positionen und Personen auseinandersetzen. Darum habe ich jetzt auch in meiner letzten Lehrveranstaltung versucht, Tools einzubauen, um ihnen Möglichkeiten zu geben, da für sich eine Sprache zu finden. Ich habe auch angeboten, fiktive Texte zu schreiben, zu alternativen Geschichten – das war konkret zur Revolution, Emanzipation in Haiti. Ich habe gesagt, sie sollen Texte schreiben, explizit fiktiv: Wer hätte was, wie, wo, anders machen können, wie hätte die Geschichte emanzipatorischer verlaufen können. Das war von mir natürlich provokativ, weil ich die Studierenden gepusht habe, sich empathisch oder sogar identifizierend mit Personen auseinanderzusetzen, die sie nicht kennen können. Es war vor langer Zeit an einem anderen Ort, ein anderer Kontext, aber ich wollte, dass sie eine Sprache finden und einen anderen Zugang finden und viele haben damit gehadert, aber viele haben das auch sehr schön gemacht, fand ich. Das war sicher provokativ, aber ich glaube, eigentlich eine gute Übung. Und was ich ebenfalls gemacht habe – und das freut mich sehr, dass das gelungen ist – ich bin persönlich auch sehr verbunden mit Tansania und bin eng im Kontakt mit Dozierenden der Geschlechterforschung in Tansania. Konkret auch (mit) einem Bachelor-Programm in Dar es Salaam. Und ich hatte eine Kollegin (dort) schon vor einer Weile gefragt, ob sie nicht Lust hat, mit mir zusammen zu unterrichten und wir haben ein Konzept entwickelt für gemeinsame Lehre acrosstheglobe. Am Anfang hiess es decolonizingfeminisms, weil das auch ein Tagungsthema war, bei dem wir präsentiert haben. Oder decolonialfeminisms, die auch von überall her dekolonial konzipiert sein können. Und im Rahmen von meinem Pro-Seminar auch einfach emanzipatorische Formen von Zusammenarbeit und Dialog. Und da hatten wir eine gemeinsame Sitzung, wo ich es irgendwie auch sehr schön fand, einen Rahmen zu haben, wo sie auch einfach miteinander sprechen können und auch aus dem rauskommen von nicht wissen wie über ‘People of Color’ zu sprechen, ohne dass jetzt irgendwie Tansania das gleiche wäre wie Schwarze Feministinnen in den USA. Aber genau, das sind so Formen, wo ich versuche auch mitzubekommen, was die Studierenden beschäftigt, was Fragen sind, die auch für die Lehre relevant sind. Wo ich sehr gezielt dann auch versucht habe, Sitzungen, Sitzungsgestaltungen und Leistungsnachweis zu gestalten, die Raum geben, genau an diesen Dingen zu arbeiten, intellektuell und persönlich wachsen zu können.»
Seminar- und Modulpläne sind häufig sehr dicht angelegt, so dass für Dozierende kaum die Möglichkeit besteht, auf inhaltliche Anliegen der Studierenden oder ihren Lernprozess zu reagieren. Im Sinne einer zugewandten und an Partizipation orientierten Lehre kann es produktiv sein, wenn eine gewisse Anzahl an Seminarterminen nicht verplant bzw. inhaltlich definiert wird. Dadurch wird es bspw. möglich, für die Auseinandersetzung mit einem Text mehr Zeit einzusetzen als vorgesehen war oder auch Studierenden die Gelegenheit zu geben, einen Veranstaltungstermin mit einem Thema zu gestalten, das ihnen im Kontext des Seminars oder Moduls besonders wichtig ist.
«Das finde ich sehr wertvoll, dass ich nur die Hälfte plane und es dann Raum hat.»Dozentin, Universität
«Ja, da habe ich auch gelernt von Studierenden oder meiner Lehrerfahrung. Am Anfang meines ersten Proseminars hatte ich versucht, alles reinzustopfen, was ich relevant fand und was mich geflasht hatte. Und es war natürlich viel zu voll und viel zu viel und es hatte dann oft auch keinen Platz für zusätzliche Fragen, die aufkamen. Oder ich habe dann gemerkt, dass wir den Text eigentlich noch gar nicht fertig besprochen haben und es eine weitere Sitzung bräuchte. Ich habe von Anfang an meinen Proseminar-Plan vorgestellt und gefragt, fehlt was oder ist was langweilig, gibt es Änderungsbedürfnisse jeder Art? Und dann kam auch mal, ‘ich fände dieses Thema noch spannend’ und dann musst ich mich fragen, wo pack ich’s rein, wenn mein Plan ja schon voll ist? Und da habe ich jetzt angefangen in meiner letzten Veranstaltung – und das möchte ich eigentlich gerne beibehalten –, dass ich nur die Hälfte vom Proseminar geplant habe, mit so Grundpfeilern und Einführungsdingern, um die Fragestellungen, Begrifflichkeiten zu klären, oder bestimmte Themen, die ich auch setzen wollte, zu setzen und die andere Hälfte habe ich leer gelassen. Und das finde ich sehr wertvoll, dass ich nur die Hälfte plane und es dann Raum hat, auf Bedürfnisse einzugehen, auf Fragen einzugehen, aber auch die Gestaltung zu öffnen, dass nicht nur ich diejenige bin, die gestaltet, sondern Studierende wissen: ‘Ah, okay, da hat es Platz und ich kann mich einbringen, ich kann einfach sagen, einen von diesen Slots, den will ich mit einem Thema, das mich flasht, füllen’. Das finde ich was sehr Schönes, so explizit auch in der Proseminar-Struktur, den Gestaltungsraum zu öffnen und auch zu reflektieren: Das habe ich gesetzt, weil ich die Dozentin bin. Ihr dürft das kritisieren, wir können das diskutieren, aber hier hat es Raum, der offen ist.»
Studierende sollten Gelegenheit erhalten, ggf. spezifische Bedürfnisse ausdrücken zu können – bspw. zu Beginn einer Lehrveranstaltung. Manche haben aber möglicherweise Hemmungen, vor einer Gruppe darüber zu sprechen. Hilfreich ist hier, wenn Dozierende den Studierenden anbieten, dass sie sich jederzeit im Nachhinein bilateral oder auch per Mail bei ihnen melden können.
Auf diese Weise kann die Bedingung dafür geschaffen werden, dass Studierende äussern, was sie brauchen, um inkludiert und ‚gut‘ an der Lehrveranstaltung teilnehmen zu können.
«…, dass man zu Beginn einer Lehrveranstaltung mehr oder weniger geschützte Räume schafft, um über Sprache die Realitäten thematisieren zu können.»Dozent, Fachhochschule
«Und was ich dann stets empfehle, ist zu Beginn einer Lehrveranstaltung oder eines Seminars oder einer Vorlesung jeweils Räume zu schaffen, wo Sprache auch entstehen kann. Also zum Beispiel, dass man zu Beginn fragt, ob jemand spezifische Bedürfnisse hat. Und dann sagt: ‚Meldet euch entweder jetzt direkt’ – manchmal wollen die das nicht – ‘oder meldet euch im Nachgang vielleicht per Mail‘. Und dann können sich die Leute auch in einem geschützten Raum äussern und auch sagen, ‚ich brauche dieses oder jenes‘. Also ich glaube gerade Leute, die vielleicht neu eine Behinderung erworben haben, oder auch vielleicht mit ihrer Identität zu kämpfen haben, die wollen darüber nicht in einem grösseren Umfeld sprechen. Und ich glaube hier verschiedene Räume zu schaffen, mehr geschützte, oder weniger geschützte, ich glaub das hilft, um über Sprache dann auch die Realitäten thematisieren zu können.»
Verwenden Studierende in einer Lehrveranstaltung diskriminierende Begriffe, sollten Dozierende darauf reagieren – aber nicht durch Aufstellen von Verboten, sondern mit sprachkritischer Reflexion. Wichtig ist, die Hintergründe solcher Begriffe offenzulegen, zu erklären, warum diese verletzend oder diskriminierend sind und Alternativen aufzuzeigen.
Entscheidend für eine konstruktive Diskussion ist u.a. die Haltung und der Gestus, mit der Dozierende einen diskriminierenden Begriff aufgreifen, wenn ein solcher während ihrer Lehrveranstaltung fällt. Es kann gerade in solchen Momenten ersichtlich werden, dass Sprache und ihr Gebrauch sozial strukturiert sind und dass gesellschaftliche Gewaltverhältnisse durch uns hindurch sprechen. Daher können diskriminierende Äusserungen auch unbemerkt oder ohne Absicht vorkommen und ohne dass die Sprechenden sich dessen bewusst sind.
Dabei ist es wichtig, eine diskriminierende Sprachanwendung nicht als individuelle Fehlleistung zu brandmarken, sondern sie als sprachlicher Ausdruck diskriminierender gesellschaftlicher Strukturen zu entlarven. Gemeinsam kann die fragliche Äusserung untersucht werden: Wo kommt der Begriff genau her? Wann taucht er zeitlich auf? Wer verwendet ihn wie? Welche Bedeutungen und Zuschreibungen impliziert er? Was leisten demgegenüber begriffliche Alternativen und wo liegen deren Schwierigkeiten?
«Wichtig erscheint mir, nicht in Richtung Verbote zu gehen, sondern die Hintergründe mit den Studierenden gemeinsam zu erkennen.»Dozent, Fachhochschule
«Also wichtig scheint mir hier, nicht in Richtung Verbote zu gehen. Ich finde das immer etwas ziemlich Schwieriges, mit Verboten zu argumentieren, statt halt zu versuchen, die Hintergründe mit den Studierenden gemeinsam zu erkennen. Also ich habe vorher den Unterschied zwischen Beeinträchtigung und Behinderung genannt. Das mal zu erklären, wo kommt das überhaupt her? Es ist eine neue, merkwürdige ‘political correctness’ – eine vermeintliche –, von Beeinträchtigung zu sprechen, weil man auf dem Pausenplatz jeweils sagt, ‘du bist ja voll behindert’, und das deshalb nicht mehr sagt. Dabei verkennt man die ganze politische Bewegung und die Geschichte dahinter. Ich glaube, das muss man dann halt erklären. Oder wenn es dann Begriffe sind, die etwas mehr in unguten Bereichen sind, dass man dann vielleicht noch mehr Zeit investiert und im Idealfall in der Gruppe oder sonst halt vielleicht auch zu zweit das Gespräch sucht.»
«Es wurde einmal interveniert, wo es um das Wort Ausländer ging, aber das fand ich nicht die beste Art, um es anzusprechen.»Student*in, Pädagogische Hochschule
“Es wurde einmal interveniert, wo es um das Wort ‘Ausländer’ ging, aber das fand ich nicht gerade die beste Art. Die Dozentin hat die Studentin dann unterbrochen und gesagt: ‘Ah, übrigens, das Wort ‘Ausländer’, ersetzt das doch lieber mit dem Begriff ‘Migrationshintergrund’, weil viele Menschen erleben das als, diskriminierend’. Sie hat sie unterbrochen, statt die Studentin ausreden zu lassen und dann ist es halt auch ein bisschen schief gelaufen, weil eine andere Studentin, die halt schlechte Erlebnisse gemacht hat mit diesem Begriff, hat dann aufgestreckt und auch noch probiert auf sie einzureden. Und die Studentin hat dann gefunden, ‘ja, aber ich meine das doch gar nicht so’ und das hat halt die andere aufgeschreckt und dann ist ein bisschen ein Konfliktgespräch entstanden. Und statt dass die Dozierende einfach Raum gelassen hat für das Gespräch, für den Konflikt, hat sie das dann unterbrochen und gesagt, sie merke, dass bringe viele Emotionen hoch, und dass sie das vielleicht nachher in der Pause ansprechen könnten, und dass wir doch weiter machen müssten mit unserem Thema. Nach dem Seminar ist dann die Studierende, die von ihren Erlebnissen erzählt hat, einfach weggegangen und die andere ist dann noch geblieben und ist mega fest versunken in ihrem ‘ach, ich Armes, ich wurde von der Dozentin und von der anderen Studentin angegriffen’. Und klar, ich verstehe, dass es als Angriff wahrgenommen wird und dass es vielleicht nicht die beste Situation war, aber ich denke, das hätte die Dozentin viel besser machen können und vielleicht auch im nächsten Seminar was sagen können. Weil ich und eine andere Studentin haben dann eine Liste mit Begriffen der Dozentin geschickt gehabt, die man gebrauchen kann statt andere Begriffe, und sie hat das dann hochgeladen und hat die anderen darauf aufmerksam gemacht und uns gedankt. In dem Seminar ging es eben effektiv um Differenzsensibilisierung und so, und ich finde, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn wir diese Liste vielleicht gemeinsam angeschaut hätten. Und vielleicht Fragen geklärt hätten, also so im Sinne von: Es gibt keine dummen Fragen, los. Wir hätten es gemeinsam anschauen können, statt es einfach hochzuladen und nur darauf zu verweisen weil so schaut sich das eben niemand an.»
Die ‘Aktivierung der Lernenden’ im Anschluss an konstruktivistische Lerntheorien ist fester Bestandteil hochschuldidaktischer Weiterbildungen und digitaler Angebote. Spiele und Methoden können helfen, um Studierende inhaltlich ankommen zu lassen und um bereits vorhandene Erfahrungen sowie vorhandenes Wissen zu ‘aktivieren’. Während dabei die Anschlussfähigkeit für neue Inhalte im Vordergrund steht, verschiebt sich der Fokus in differenzsensibler Perspektive vom Konzept der Aktivierung hin zur Involvierung. Also dem Versuch, eine Atmosphäre der Anerkennung und des Vertrauens zu erzeugen, Studierende aus der Anonymität zu holen und mit ihrem Wissen erkennbar werden zu lassen.
Die Verschiebung verweist auf die Bedeutung des Konzepts generischer Co-Kreation, das den individuellen Anteil der Lernenden an der Wissensvermittlung betont sowie die aktive Rolle der Studierenden und die reziproke Natur des Lehr-Lern-Prozesses einbezieht (siehe dazu den Eintrag zum didaktischen Dreieck).
«Es ist wichtig zu verstehen, als Dozierende ist das Sprechen so selbstverständlich, aber ja für die Lernenden nicht.»Dozentin, Universität
«Also was, glaube ich, wichtig ist, ist zu verstehen, dass als Dozierende ist das Sprechen so selbstverständlich, aber ja für die Lernenden nicht. Und, ähm, da zu überlegen, wie bringe ich die Menschen dazu, sich zu äußern. Und das kann ja ganz minimal sein im Sinne von, wir machen mal kurz Zweier- oder Dreiergruppen zu was, um das auch systematisch wirklich einzubauen. Also nicht nur in dem Moment, wo ich merke, so, ah, jetzt klappt es grad nicht, sondern wirklich zu sagen, wie können wir das aufbauen von einer einzelnen Wortmeldung eben hin zu einem Gruppengespräch und wie kriegen wir das zurückgekoppelt. Es gibt eine Methode, die ich unglaublich toll finde, wenn es um so Ergebnissicherung geht gemeinsam. Ich habe leider den Namen vergessen dieser Methode, aber ich liebe sie. Ähm, dass die zentralen Begriffe zu einem Thema aufgeschrieben werden von allen, also es müssen wie 10 Begriffe sein und dann tauscht man sich erst so 2 draus und muss das wieder auf 10 gemeinsame Begriffe reduzieren und so geht das weiter, bis man 2 Gruppen, also 2 oder 3 Gruppen je nach Seminargröße hat, die damit dann ein Schaubild machen müssen. Und dann sozusagen eine Systematik vorstellen gemeinsam, dann ist das was wirklich sehr, sehr eigenständig gearbeitet ist in diesen Gruppen. Und darüber dann zu fragen, warum habt ihr das so gemacht, wie seht ihr das? Danach habe ich immer das Gefühl, wenn wir das gemacht haben, sind alle voll, voll dabei und haben es mitgedacht und wir sind uns einig, wie wir diese Dinge verstauen können, sozusagen in unserem mentalen Gepäck. Das finde ich zum Beispiel eine Methode, die sehr gut funktioniert. Und da muss ich eigentlich dann ganz wenig machen. Also ich muss es wirklich nur anleiten, ich muss auf die Zeit gucken und am Schluss die Diskussion moderieren. Aber das sind Dinge, die wirklich zur Aktivierung der Gruppe beitragen.»
Von einer umsichtigen Gestaltung der Lehre, die verschiedene Beeinträchtigungen mitdenkt, profitieren Studierende mit und ohne Behinderung. So unterstützt bspw. die Beschreibung dessen, was ein Bild zu sehen gibt, auch die Wahrnehmung derjenigen, die keine Sehbehinderung aufweisen. Wenn Dozierende den – sehr sitz- und sprachorientierten – Unterrichtsdialog mit Bewegung kombinieren, bspw. um Stimmungsbilder in einer Gruppe räumlich-körperlich abzubilden, dann kommt das ebenfalls allen Studierenden zugute. Dies im Sinne einer abwechslungsreichen, anregenden Lehre. Eine Berücksichtigung folgender Aspekte kann zu einer möglichst hindernisfreien Kommunikation in der Lehre beitragen:
- Fragen Sie die Studierenden, ob sie gut zu verstehen sind. Bitten Sie darauf hingewiesen zu werden, wenn Sie lauter oder langsamer sprechen sollen.
- Versuchen Sie in der mündlichen Kommunikation zu vermitteln, dass Sie sich für den Inhalt des Gesprochenen interessieren und nicht für die Art des Sprechens.
- Bieten Sie unterschiedliche Möglichkeiten der Beteiligung an, die über das Sprechen vor allen Studierenden hinausgehen.
- Verwenden Sie eine multimodale Kommunikation, also kombinieren Sie verschiedene Kommunikationsmittel (z.B. Sprache, Bilder, Symbole), um Informationen effektiver zu vermitteln. Das Ziel ist es, das Lernen interessanter zu gestalten und die Informationen besser im Gedächtnis zu verankern.
- Lassen Sie den Studierenden inhaltliche Bestandteile der Veranstaltung schriftlich zukommen. E-Learning-Support oder Informationsforen via Mail verhindern Missverständnisse und unnötige Stresssituationen für die Betroffenen.
- Signalisieren Sie explizit Offenheit für die Nutzung technischer Hilfsmittel zur Sprach- respektive Hörunterstützung.
- Berücksichtigen Sie, dass freies Sprechen vor einer Gruppe, nicht nur bei sprachbehinderten Menschen, angstbesetzt sein kann und Selbstvertrauen verlangt (Phänomen Sprechangst, Stimm-, Artikulations- und Sprechrhythmusprobleme wie bspw. Stottern).
- Berücksichtigen Sie, dass Probleme beim Lesen oder Schreiben auch ein Hinweis auf eine Lese-Rechtschreibschwäche (Legasthenie, Dyslexie) sein können.
- Hinweise dazu, wie digitale Informationen möglichst zugänglich für alle gestaltet werden können, finden Sie unter räumlich-technische Infrastruktur sowie hier.
«Eine hindernisfreie Lehre nützt am Ende nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern sie nützt allen Menschen.»Dozent, Fachhochschule
«Ja, also, der Klassiker ist ja immer, ähm, visuelle, ähm, Lehrmittel zu verwenden, wenn jemand nichts sieht. Dann wird’s schwierig. Wenn ich dann halt von Beginn weg eher nicht auf visuelle oder weniger auf visuelle, nicht nicht, aber weniger auf visuelle, äh, Inhalte setze und mehr über die Sprache, dann ist das meistens überhaupt kein Problem. Ähm, und gleiches ist es natürlich auch bei Leuten, äh, die nichts hören, wenn vieles übers Gehör geht, ähm, dann, dass man dann andere Wege sucht. Aber wenn du mich noch nach einem konkreten Beispiel fragst, ähm, Diskussionen organisieren, ähm, normalerweise sitzt die Klasse in ihren Reihen und jeder schaut nur nach vorne. Viele Menschen mit Hörbehinderung lesen von den Lippen ab und das ist dann schwierig bis unmöglich. Das heißt, dass man dann zum Beispiel ein anderes Sitz-Setting, äh, organisiert, dass man zum Beispiel im Kreis ist oder in einem U, so dass die Person jeweils auf die Lippen der sprechenden Person schauen kann. Darüber hinaus halt dann sehr wichtig zu schauen, dass die Leute nicht miteinander sprechen, also nicht gleichzeitig sprechen, ähm, nicht drei haben gleichzeitig eine Idee und jeder versucht, die gleichzeitig zu äußern, dann kann man nicht dreifach Lippen ablesen. Wenn man das aber strukturiert und etwas moderiert, ist es ja auch da wieder, äh, das hilft allen. Auch alle hörenden Menschen sind froh, wenn nicht drei gleichzeitig reden und, ähm, ich glaube, das zeigt einmal mehr, eine hindernisfreie Lehre nützt am Ende nicht nur Menschen mit Behinderung, sondern sie nützt allen Menschen.»
Flexibilität in den Lehrmethoden ist insbesondere für eine differenzsensible Lehre unabdingbar. Bereits in der Vorbereitung des Unterrichts müssen die Dozierenden die unterschiedlichen Lernbedürfnisse der Studierenden mitdenken und die Effekte einer gewählten Unterrichtsform (bspw. plenare Diskussion oder Diskussion in Kleingruppen) auf die Lehr-Lern-Situation antizipieren.
So wirkt sich bspw. die frontale Sitzanordnung in Reihe auf die Art und Weise einer plenaren Diskussion aus. Menschen mit Hörschwierigkeiten, die mitunter darauf angewiesen sind, dass sie die Gesichter der Sprecher*innen sehen können, können in einem solchen Setting mangels Sicht den Beiträgen nicht folgen. Manche Studierende ermüden zudem generell schnell, wenn überwiegend gesprochen wird. In solchen Fällen braucht es körperbezogene Phasen und es stellt sich die Frage, ob die Form des Unterrichtsgesprächs sowie der Gruppendiskussion mit dieser Gruppe und in diesem Setting sinnvoll ist und was Alternativen sein könnten.
Beim Erschliessen und Explorieren von Theorie-Texten können alle Studierenden davon profitieren, wenn es die Möglichkeit gibt, ein*e Expert*in einzuladen, um mit ihm*ihr im Gespräch über Fragen zu sprechen, die in einem Text verhandelt werden. Überhaupt ist der Einbezug von Gästen eine gute Möglichkeit, verschiedene Perspektiven in die Lehre einzubringen und dadurch die diskutierten Inhalte vielstimmiger zu gestalten.
«Welche didaktischen Methoden ich anwende, ist immer auch davon abhängig wer im Publikum sitzt. Und welche Bedürfnisse dort vorhanden sind.»Dozent, Fachhochschule
«Also, was ich für Methoden oder didaktische Methoden auch anwende, ähm, ich glaube, das ist immer ein bisschen auch davon abhängig, da habe ich jetzt vielleicht eine etwas erhöhte Sensibilität dafür, wer im Publikum sitzt und welche Bedürfnisse dort auch vorhanden sind. Ich habe ja vorhin einige Beispiele, äh, genannt, äh, wie zum Beispiel, wie erkläre ich eine Grafik, wenn jemand nicht sieht, oder wie moderiere ich eine Diskussion, wenn Menschen mit Hörbehinderung dabei sind, was muss ich dabei beachten? Ich glaube, das sind Fragen, die viele Lehrpersonen, äh, überfordern, wenn sie damit nicht vorgängig sich beschäftigt haben. Ich glaube aber, es lässt sich erlernen. Und damit würde ich sagen, je nachdem, wer bei mir im Publikum sitzt, (.) ähm, mache ich vielleicht mehr Diskussionen oder eher etwas weniger Diskussionen. Wenn ich weiß, dass Diskussionen für Menschen mit Hörbehinderung stets eine große Herausforderung sind, dann lasse ich die natürlich nicht weg, versuche ein entsprechendes Setting zu schaffen, wo das möglich ist, aber ich setze da vielleicht jetzt nicht den ganz grossen Schwerpunkt. Und ich glaube, so auch eine Flexibilität, ich glaube, das ist das Stichwort, eine Flexibilität in den Lehrmethoden auch zu haben, je nach Bedürfnisse, die dann auch, ähm, auf mich zukommen. Ich glaube, das ist sicherlich, ähm, für mich etwas sehr Zentrales.»
«… wie ein Text anders erfahrbar werden kann jenseits von wir sitzen da und lesen.»Dozentin, Universität
«Also ich entwickle gerade ein Seminar zu Judith Butler mal wieder zur, ähm, Macht der Gewaltlosigkeit, das werde ich im Herbst in Zürich unterrichten. Und das ist ja genau die Frage, da werden Menschen sein, die haben noch nie vorher Judith Butler gelesen. Die ist ja nicht ganz anspruchslos als Denkerin, das heißt, es braucht einfach viele Voraussetzungen, um diese Texte erstmal für sich aufschlüsseln zu können. Und da zu sagen, was könnte es geben, also welche Texte stelle ich dazu, ähm, das können Sekundärtexte sein, die sich direkt mit Butler beschäftigen, das können aber auch wirklich andere Denker und Denkerinnen sein, die es wichtig ist zu verstehen, ähm, um nachzuvollziehen, was sie da versucht zu formulieren, oder was sie da formuliert in ihren Texten. Und dadurch sozusagen ist es nicht nur der eine Text, den man jetzt irgendwie versucht aufzuschlüsseln, sondern man nähert sich dem ja auch an und schafft sozusagen wie verschiedene Möglichkeiten auch den Text zu erfahren. Das ist auch nochmal ein Punkt, über den ich gerade viel nachdenke, sozusagen, weil wir so viel mit Text arbeiten, wie der eigentlich auch nochmal anders erfahrbar werden kann, jenseits von wir sitzen da und lesen. Also, ich lese ja wahnsinnig gern laut auch Texte und finde das unglaublich hilfreich. Ich stelle auch fest, wenn ich selber schreibe, lese ich laut mit oder schreibe laut, weil das für mich was macht. Und ich glaube, dass sozusagen Textlesen auch manchmal dialogischer noch funktionieren könnte in so einem Raum. Und da, genau, das wäre noch so eine Frage von Form, jetzt nicht das, was man dann in das Curiculum packt, sondern eher so die Form, in der man das dann auch bearbeitet. Wenn es um Theorie geht, arbeite ich tatsächlich gerne mit Text und da ist eben genau die Frage, wie kann man den noch anders erfahrbar machen, jenseits von wir lesen den alle für uns still. Das ist vielleicht manchmal auch wichtig, aber es gibt eben auch Passagen, die es sich lohnt, laut vorzulesen und dann nochmal ins Gespräch zu gehen miteinander, weil dann nochmal was passiert. (.) Und was ich sonst auch sehr mag, wenn es auch thematische Seminare sind, ist wirklich dialogisch zu arbeiten. Das heißt wirklich auch Menschen einzuladen, die sich mit Themen beschäftigen. Dann spreche auch nicht nur ich. Also dieses in dem Gespräch was erläutern ist auch ein anderes Format als einfach monologisch. Auch wenn man Inputs vergibt und so, oftmals ist es ja dann so, dass eine Person sehr lange redet, wie ich jetzt gerade auch in diesem Interview und es ist eigentlich schöner, wenn es so mehr im Gespräch passiert, weil ich glaube, man kann besser zuhören und man kann dem länger folgen auch. (..) Und die Möglichkeit ist, da Nachfragen zu stellen. Das ist was, was ich sehr gerne mache und auch um deutlich zu machen, es gibt immer auch wie so ein Netzwerk oder also Menschen, die sich mit bestimmten Themen beschäftigen, sozusagen die auch sichtbar zu machen auf eine andere Art und Weise oder hörbar zu machen auf eine andere Art und Weise als nur über eine Fußnote in einem Text. Diese Verbindung, das sind Menschen, das sind sozusagen Kontexte, die da mitkommen und ich glaube, das macht was, die zu erleben.»
Behinderungen und chronische Erkrankungen wirken sich individuell sehr unterschiedlich aus. Bei einem Nachteilsausgleich sollte daher – im Sinne von good practice – zusammen mit den Betroffenen spezifisch angeschaut werden, wo ganz genau der Nachteil liegt und wie dieser ausgeglichen werden kann. Auf dieser Grundlage kann dann punktgenau nach Möglichkeiten gesucht werden, wie Studienalltag und allfällige Prüfungssituationen so gestaltet werden können, dass sie auch mit Behinderung oder Erkrankung bewältigt werden können, und zwar so, dass die zentralen inhaltlichen Anforderungen einer Ausbildung/Prüfung ebenfalls erfüllt werden (siehe Eintrag zum Nachteilsausgleich unter Dimensionen).
«… ein Nachteilsausgleich ist immer ein individuelles Instrument. Nur weil jemand eine Sehbehinderung hat, braucht er nicht immer das gleiche.»Dozent, Fachhochschule
«Während einige Hochschulen dies relativ professionell machen, (.) auch darum wissen, und ich glaube, das ist ganz zentral, dass ein Nachteilsausgleich immer ein individuelles Instrument ist. Nur weil jemand eine Sehbehinderung hat, braucht er nicht immer das Gleiche. Es gibt nicht die Sehbehinderung. Es gibt ganz unterschiedliche Bedürfnisse, auf die unterschiedlich reagiert werden müssen, um wirklich den Nachteil auszugleichen. Ähm, und das ist an einigen Hochschulen läuft das relativ gut, und aber an vielen Hochschulen nicht. Also ich glaube, es gibt immer noch viele Hochschulen, die haben Regeln, wie zum Beispiel jemand hat, Behinderungsart XY, also geben wir 50 Prozent mehr Zeit, auch wenn es überhaupt keinen Sinn macht. Und ich glaube, das sind Sachen, wo es einfach eine Professionalisierung braucht, und es nicht ausreicht, wenn man nach Standard irgendwelche Rezepte aufstellt, und die dann einfach abspult. Es braucht ja ein Commitment, es braucht Ressourcen, um das entsprechend professionell überall zu machen.»
«…dass man wirklich zuhört und auch mit Fachwissen dann versucht, das zu reflektieren…, wo liegt der Nachteil ganz genau.»Dozent, Fachhochschule
«Also eine Good Practice ist beispielsweise, wie ich jetzt erwähnt habe, jemand hat einen gewissen Nachteil aufgrund einer Behinderung und kann das dann, ähm, erläutern und erklären, wo liegt der Nachteil, dann kann man diesen genau feststellen. Und aufgrund dieses Nachteils sucht man den konkreten Nachteilsausgleich. Also jemand braucht zum Beispiel eine Schreibhilfe. Also kann ich für mich als Beispiel meine Wenigkeit anführen an meiner Abschlussprüfung an der Uni. Ich konnte die damals existierende vierstündige Prüfung nicht in einem Zug so durchschreiben mit meinen Händen. Also hatte ich jemanden, der für mich geschrieben hat und ich hab’s diktiert. Das ist aber sehr individuell verschieden. Ich glaube einfach, dass man wirklich zuhört und auch mit Fachwissen dann versucht, das zu reflektieren, wo liegt der Nachteil ganz genau. Manchmal gibt es Menschen, die kennen ihre Situation noch nicht ganz so genau, dass man die Leute unterstützt und das dann gemeinsam herausfindet und das dann macht. So, das wäre der Idealfall. In der Praxis gibt es dann immer wieder viele Hürden. Beispielsweise jemand mit einer psychischen Behinderung braucht vielleicht einen Raum, der ruhig ist und kann nicht mit 300 Studierenden zusammen im gleichen Raum sitzen. Es braucht vielleicht einen Extraraum. Und dann heißt es plötzlich, wir haben keinen Raum. Das ist so ein Klassiker. Oder man sagt, du kriegst 50 oder 20 Prozent mehr Zeit. Die eine Person braucht vielleicht 40, die andere nur 10 Prozent, weil man einfach ein Rezept abspult, ohne sich wirklich damit auseinandergesetzt zu haben, was ist denn der individuelle Nachteilsausgleich dieser Person.»
«… ich wollte in meinen Nachteilsausgleich einbeziehen, dass Prüfungen nicht am Abend stattfinden, denn an dem Punkt sind meine Medikamente nicht mehr wirksam.»Student*in, Pädagogische Hochschule
«Das grösste Beispiel, was mir einfällt, ist (folgendes): Bei (meinem) Nachteilsausgleich ging es darum, dass ich den erweitern wollte und zwar, damit (für mich) Prüfungen nicht am Abend stattfinden, weil ganz viele Prüfungen oft von sechs bis acht am Abend stattfinden. Und an dem Punkt sind halt meine Medikamente nicht mehr wirksam und ich wollte das in meinen Nachteilsausgleich mit einbeziehen. Dann hiess es, es brauche eine Bestätigung von einer ärztlichen Fachperson, dass das auch der Fall ist. Und ich dachte nur so, ja gut…, also ich meine, das kann jede Person googeln gehen und sehen, dass es keinen Sinn macht, Medikamente so spät noch einzunehmen, weil ich dann nicht mehr schlafen kann, weil es dann halt trotzdem ein Amphetamin oder sonst ein Medikament ist, das Schlafschwierigkeiten auslöst, plus, dass diese Medikamente halt nicht spät eingenommen werden können, sondern direkt wenn man aufsteht. Und darüber habe ich halt keine Kontrolle, ich richte meinen Schlafzyklus ja nicht nach der Prüfung. Und dann bin ich zu meiner damaligen ADHS-Psychiaterin, habe ihr das gesagt, und sie meinte dann so: ‚Hey, um so einen Bericht zu schreiben, das kann ich schon machen, aber das zahlt die Krankenkasse nicht, weil es halt nicht etwas ist, das du sozusagen brauchst, und das sind von meiner Seite ein bis zwei Stunden Aufwand’. Das wären mindestens 300, maximal 600 Franken gewesen. Und dann habe ich das der Person beim Nachteilsausgleich gesagt und dann gesagt, dass sie mich sonst auch zu einem Vertrauensarzt oder so schicken oder halt das Geld übernehmen könnten. Aber dass ich mir das halt nicht leisten könnte. Und dann hat es geheissen, ‘nein, tut uns leid, das brauchen wir schriftlich, das können wir nämlich nicht umsetzen. Weil, wenn wir das (bei) Ihnen einfach so umsetzen, dann kann das jede Person bekommen’. Und ich dachte dann, okay und habe dann recht schnell aufgegeben, weil ich dachte, weisst du was, nee, kein Bock dafür, da ich eh nur noch ein paar Semester da studiere, und hoffentlich passiert es nicht mehr, dass Prüfungen so spät stattfinden. Aber diese Begründung ‚wenn wir es bei dir zulassen, dann werden es alle wollen’… (Dabei verstehen so) wenige Menschen überhaupt, dass es einen Nachteilsausgleich gibt. Plus halt dieses – also ich paraphrasiere, ich weiss nicht mehr genau, was die genauen Worte waren – aber so etwas à la, ‘ja, das ist halt der Rahmen, der uns gegeben wird, um bestimmte Ausgleiche geben zu können und bei ADHS ist halt das hier nicht vorgegeben’. Und das hat mir wieder gezeigt, aha, das ist einfach kein massgeschneidertes (Angebot), sondern einfach diese drei oder vier Sachen, die erlaubt werden und alles andere nicht. Zum Beispiel auch so etwas wie ein reizabgeschirmter Prüfungsort ist auch nur möglich – und das steht auch im Nachteilsausgleich so – wenn es die Infrastruktur erlaubt. Also das heisst, es muss eine Person geben, die mich betreut während dieser Zeit und es muss einen freien Raum geben während dieser Zeit. Was zum Glück bisher immer funktioniert hat, aber nur schon das Wissen, dass das nicht mein Recht wäre, wenn es mal der Fall wäre…, das ist extrem stressig. Plus, dass ich als studierende Person der dozierenden Person hinterherrennen muss. Es ist natürlich auch klar – wie soll ich sagen – dass ich nicht einfach alles so serviert bekomme, sondern dass ich mich auch ein bisschen bemühen muss um bestimmte Sachen, aber genau mit ADHS sind das genau so Sachen, die für mich nachher sehr gross wirken und sehr schnell auch vergessen werden. Und das fände ich halt cool, wenn das schon mitgedacht werden würde.»
Wer studiert, begibt sich in institutionell vorgegebene Prozesse, die von Dozierenden individuell ausgestaltet werden. Damit sich Studierende sicher durch ihr Studium bewegen können, ist es entscheidend, dass Dozierende zu Beginn eines Semesters aktiv für eine gemeinsame Grundlage darüber sorgen, wie die Zusammenarbeit stattfinden soll: Welche Setzungen bestehen, wo liegen die Spielräume, welche Erwartungen werden an die Studierenden gerichtet? Wofür sorgen die Dozierenden und was liegt in der Verantwortung der Studierenden?
Klarheit und Planbarkeit im Organisatorischen tragen ebenfalls dazu bei, eine gute Basis für die Zusammenarbeit mit Studierenden zu schaffen. Dies betrifft bspw. die frühe Bekanntgabe der formalen Anforderungen und Abgabetermine von Leistungsnachweisen sowie das frühzeitige Aufschalten von Ablaufplänen für das jeweilige Semester.
Zur Orientierung im organisatorischen Ablauf einer Lehrveranstaltung kommt die Orientierung in den Inhalten. So bewegen sich Dozierende geübt und wie selbstverständlich in ihren Disziplinen. In ihnen sind sie ‚zu Hause‘. Betreten nun Studierende dieses Haus, fehlt es häufig an Orientierung und an Wissen darüber, was sich wo befindet oder wer sich früher hier aufgehalten hat. Zudem gibt es innerhalb dieses Hauses viel Dynamik und alles ist in Bewegung, finden stets Um- und Anbauten statt.
Aus diesem Grund unterstützt eine differenzsensible Lehre Studierende darin, sich im Modulverlauf und in den Inhalten orientieren zu können. Sie bettet beides in den Kontext der jeweiligen Disziplin und des Studiengangs ein. Die Verwendung der Sprache und ein zugewandter Gestus sind dabei entscheidend: Alle sollten sich bestmöglich selbstständig «im Haus» bewegen und Dinge in Gebrauch nehmen können.
«Mir hilft, wenn anfangs Semester wie ein Grundstein gelegt wird, wie die Gruppe gemeinsam mit dem Dozierenden zusammenarbeiten soll.»Studentin, Pädagogische Hochschule
«Mir hilft, wenn am Anfang des Semesters, wie ein Grundstein gelegt wird, wie die Gruppe mit, gemeinsam mit dem Dozierenden zusammenarbeiten soll und dann auch so wie Knigge Regeln definiert werden, welche Sprache wird verwendet, welche Begriffe, ähm, wann, wann, wann, also irgendwie auch dieses, diese Verantwortlichkeiten herstellen mit pünktlich kommen oder keine Ahnung, also auch wenn man dann zu spät kommt, einfach das so wie klar ist, okay, das, so möchten wir miteinander unterwegs sein, ähm. Aber da ist es ein feiner Grad zwischen gekünstelt und, ähm, wirklich aufrichtigem Knigge herstellen. Und was mir sonst noch hilft, ist einfach, wie das Gefühl, dass die Person erreichbar ist und dass ich, ähm, dass ich diese Person ansprechen kann und dass auch Beobachtungen seitens der Studierendenseite geschätzt werden und eben dieses Negativbeispiel mit der, dieser Woke-Kultur, will diese Person nicht im Seminar haben, das hat, ist mir so eingefahren, da dachte ich mir einfach so, that’s not how to do it, ähm, weil es fällt ja auf, ich bin sicher nicht die einzige Person, der das aufgefallen ist, dass diese Sprache verwendet wurde und, ähm, das finde ich dann schade. Anstatt das als Lernmoment zu sehen, was von uns im Umkehrschluss als Studierenden viel später im Schulzimmer oft gefordert würde.»
«Dann stehst du da und hast irgendwie vier Seminare gebucht, die alle zur gleichen Zeit die Abgabe haben…»Student*in, Pädagogische Hochschule
«Was ich auch sehr wichtig fände, wäre, wenn von Anfang an, ähm, bei den Kursbeschreibungen, wenn die aufgeschaltet werden, (..) dass die Leistungsnachweise schon, also natürlich nicht der genaue Leistungsnachweis, aber es wird eine schriftliche Arbeit sein mit der Abgabe von ungefähr Woche XY. Das fände ich halt wie sehr sinnvoll, weil das wird oft nicht gemacht und dann stehst du da und hast irgendwie vier Seminare gebucht, die alle zur gleichen Zeit die Abgabe haben und bist so, ach, okay, dann muss ich halt im Oktober schon anfangen irgendwie, ähm, ja, oder auch so, das fände ich jetzt halt vom Zeitmanagement her auch sehr hilfreich, wäre, wenn, ähm, der ungefähre Semesterplan auch schon aufgeschaltet wäre, ähm, nicht, dass das erst irgendwie in der ersten Woche vom Seminar, ähm, dann die genauen Zeiten bekannt gegeben werden, so dass man wie schon weiß, auf was man sich einlässt. Also viele Dozierende haben sich ja nach Covid schon angepasst mit dem Selbststudium, aber viele Dozierende auch nicht. Viele Dozierende finden nach wie vor, nein, wir treffen uns jede Woche vor Ort, obwohl es wirklich nicht sinnvoll ist oder sinnvoll wäre. Aber ich finde schon, dass sich nach Covid sehr viel verändert hat mit diesen Selbststudiumsequenzen, was ich sehr positiv finde.»
Je nach Hochschulkultur, aber auch nach Art und vor allem Grösse der Lehrveranstaltung kann es für Lehrende sinnvoll sein, die Studierenden kennenzulernen und dafür Sorge zu tragen, dass sich auch die Studierenden untereinander kennenlernen können.
Nicht unbedingt neu, aber für viele eher ungewohnt, sind so genannte Pronomenrunden – die Nennung des Pronomens, mit dem man angesprochen werden möchte (z.B. Sascha, sie/ihr oder Sascha, er/they oder Sascha, keine etc.) – in der Anfangsphase einer Lehrveranstaltung. Eine Pronomenrunde signalisiert Akzeptanz gegenüber Selbstbezeichnungen. Wenn Dozierende ihr eigenes Pronomen proaktiv benennen und andere dazu ermutigen, signalisieren sie ihre Offenheit für eine gewünschte Anrede.
Der Akt des Benennens der eigenen Geschlechtsidentifikation kann aber auch Unbehagen und Widerstände auslösen, insbesondere bei denjenigen, die sich noch nie bewusst oder aktiv damit auseinandergesetzt haben. Dies müsste vor einer Durchführung bedacht werden, so dass dafür ein guter Zeitpunkt gewählt wird und/oder dass Dozierende etwaiges Unbehagen auffangen können.
Die Nutzung von Neo-Pronomen (sier, dey oder hen) beim Sprechen ist für viele ungewohnt. Wer damit sicherer werden möchte, kann das Ersetzen der üblichen Pronomen auf dieser Website üben: http://www.neopronomen.nrw/
Ressource:
Pronomen/Anredeformen • Stabsstelle Diversity und Antidiskriminierung • Freie Universität Berlin
«Als ich angefangen habe zu studieren, haben wir Geschlechternormen kritisiert und Binarität hinterfragt, aber Pronomenrunden in dem Sinn gab es nicht.»Dozentin, Universität
«Und dann einen weiteren Punkt, wo ich auch von Studierenden eigentlich gelernt habe, ist, dass es immer mehr Thema ist, auch sich selber zu situieren, also nicht nur wissenschaftlich zu situieren, sondern auch persönlich zu situieren und vor allem die Diskussion um Pronomen. Und das war, genau, als ich angefangen habe zu studieren, haben wir Geschlechternormen kritisiert und Binarität irgendwie hinterfragt, aber Pronomenrunden in dem Sinn gab es nicht. Und für mich war das eine sehr spannende Entwicklung auch mit den Pronomen, weil mein Weg durch die Geschlechterforschung auch stark war, überhaupt zu realisieren, inwiefern ich weiblich sozialisiert bin, inwiefern ganz viele von den Dingen, die ich in meinem Alltag tue, in meinem Denken, in meinem Fühlen, inwiefern das ja nicht allgemein menschlich, sondern weiblich sozialisiert ist. Und gleichzeitig geht es sowohl im Studium als auch mir persönlich um eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Normen und auch eine eigene Gestaltung, eine Abgrenzung von diesen Normen. Das heißt, wenn dann die Anforderung kam, so, und jetzt, was ist deine Geschlechtsidentität und dein Pronomen, war ich in einem ersten Moment auch überrumpelt. Aber ich fand es sehr toll, auch dann das zum Thema zu machen. Also ich weiß, dass das eine Diskussion ist, die in der Geschlechterforschung und bei den Studierenden wichtig ist. Das heißt, ich schaue eigentlich immer, dass ich Non-Binarität, Trans, dass ich eine Sitzung dazu habe, wo klar ist, die inhaltliche Auseinandersetzung dazu hat einen Platz. Und wir besprechen das. Aber genau, ich situiere mich mittlerweile auch sehr viel ausführlicher. Und also gerade auch, dass ich um einen Raum eigentlich zu öffnen, weil ich finde es sehr wertvoll, wenn Personen das für sich geklärt haben, ihr Pronomen, ihr Geschlecht, das irgendwie auch so auszusprechen. Auch schon alleine, dass man weiß, wie spricht man Menschen an, ohne sie zu verletzen auch. Und das ist ja auch inhaltlich ein wichtiger Punkt in der Geschlechterforschung, nicht die unsichtbare Norm zu behalten. Und die, die anders sind, sollen sich markieren. Also das haben wir lange eigentlich problematisiert als ein Mechanismus. Gleichzeitig für Menschen, die am Suchen sind und am Ringen sind, dass es da auch keinen Zwang gibt, sondern irgendwie eine offene Haltung. Aber auch klar, es gibt Raum, darüber zu sprechen.»
«So Sachen wie Pronomenlisten fände ich noch recht cool, wenn das umgesetzt werden würde.»Student*in, Pädagogische Hochschule
«Ja, so Sachen wie Pronomenlisten fände ich noch recht cool, wenn das umgesetzt werden würde, ähm, (.) oder, oder zum Beispiel schon nur beim Vorstellen, ähm, dass es wie normalisiert wird, die Pronomen zu sagen, statt dass nachher immer die Ausnahme, die Abweichende, die Person mit der Abweichung dann immer sagen muss, und mein Pronomen ist übrigens dies oder das. Ähm, das führt dann immer so dazu, dass man im Mittelpunkt gestellt wird, ähm, ja, und, oder zum Beispiel, dass man dann immer den Dozierenden im Vorhinein ein Mail machen muss, damit es dann gar nicht erst vorkommt, irgendwie Frau XY, der Herr XY genannt zu werden, sondern einfach nur beim Vor- oder Nachnamen, ähm, das ist eben zum glück mittlerweile, (…) also eigentlich wird den Dozierenden ja empfohlen zu Siezen,aber machen viele nicht, wenn das Einverständnis in allen Studierenden, ähm, eingeholt wird, und das finde ich schon viel einfacher, weil dann fällt eben dieses Frau und Herr weg, ähm, ja.»
Auch in Lehrveranstaltungen kommt es zum Einsatz diskriminierender Karikaturen und Comics. Studierende sind diesen dann ausgesetzt und äussern sich oftmals aus Furcht vor negativen Folgen nicht.
Rassialisierte Karikaturen werden häufig unter Hinweis auf die Kunst- und Meinungsfreiheit verteidigt und Kritik daran als Ausdruck einer vermeintlichen Political Correctness abgetan. Der Effekt davon ist, dass sich rassistisches Sprechen legitimiert findet und Rassismuskritik zugleich delegitimiert wird – ganz nach dem Motto ‘Das wird man wohl noch sagen dürfen’, wie der Sozialanthropologe Rohit Jain analysiert (siehe sein Artikel: Das Lachen über die «Anderen»: Anti-Political-Correctness als Hegemonie).
Es liegt in der Verantwortung der Dozierenden, einer solchen Form der Normalisierung von Rassismen in Lehrveranstaltungen (!) nicht leichtfertig nachzugeben und im Zweifel auf die Verwendung einer Karikatur oder eines Comic-Strips entweder zu verzichten oder sich bspw. von der Diversity-Fachstelle der eigenen Hochschule beraten zu lassen.
«…rassismuskritische Bildsprache sollte ein Thema sein, gerade wenn man Karikaturen oder Comics verwendet…»Studentin, Universität
«Ja, ähm, ich finde auch, dass dort so rassismuskritische Bildsprache, dass das unbedingt ein Thema sein sollte, gerade wenn man Karikaturen oder Comics verwendet, dass man dort einfach wirklich vorsichtig ist und sich dreimal überlegt, ob man diese Karikatur jetzt einfach zeigt oder aufhängt oder irgendetwas damit macht. Weil, ja, ich finde, klar ist da immer so, Satire soll auch das dürfen, aber ich finde, irgendwie an der Universität hat das nicht zu suchen. Auch weil man einfach so in einem Machgefälle ist als Studierende. Man ist ja wie so den dozierenden Personen ausgeliefert, sie bewerten einen und dann ist es einfach noch mal schwieriger zu sagen, wow, ich finde diese Karikatur so wahnsinnig verletzend, kannst du die wegnehmen. Das ist so das, was mir in den Sinn kommt. Oder so typisch stereotypische Bilder, finde ich, ach, wenn ich da manchmal so in den Sozialanthropologie-Lesungen sitze, bin ich mir wirklich so: Aah! wieso? Lieber keine Bilder, also, ja.»
So genannte Sprachleitfäden bilden ab, wie sich Hochschulen insgesamt oder einzelne Fachbereiche zur Frage nach sprachlicher Repräsentation gesellschaftlicher Minderheiten positionieren. Sie regeln, wie der Anspruch einer inklusiven Sprache in die Praxis umgesetzt werden kann. Je nach Hochschule kann ein Sprachleitfaden auf das Ziel der Geschlechtergerechtigkeit fokussieren oder bereits darüber hinausgehend weitere Differenzkategorien berücksichtigen und dazu beitragen wollen, dass stereotype Zuweisungen insgesamt unterbrochen werden. Letztere wollen zu einer inklusiven Sprache beitragen – im Unterschied zu Leitfäden für eine geschlechtergerechte Sprache.
Sprachleitfäden bieten Orientierung und helfen dabei, die Kommunikation in der Lehre sowie auf anderen Ebenen der Hochschule zu gestalten.
«Wenn ich an eine Institution gehe, dann gucke ich, was gibt es für Vorgaben und dann ist aber auch die Frage, wie kann ich die mit meinen Standards übereinbringen oder nicht.»Dozentin, Universität
«Und das gilt natürlich auch für die schriftlichen Arbeiten. Also, da einem Rückmeldung zu geben entsprechend, wenn ich finde, was ist nicht gelungen. Ähm, und auch zu überlegen, ähm, wenn man verantwortlich ist, auch in einem Team, was für Sprachleitfäden gibt es an der Institution? (.) Ähm, was ist da der Standard, den man auch festlegen will und kann im Rahmen von so einer Struktur? Das ist ja dann manchmal gar nicht so einfach. Also, wenn ich an eine Institution gehe, dann gucke ich natürlich, was gibt es für Vorgaben erstmal auch, ähm, und, ähm, und dann ist aber auch die Frage, wie weit kann ich die ja auch sozusagen mit meinen Standards übereinbringen oder nicht? Also, dann muss ich das ja auch sichtbar machen und sagen, das ist sozusagen das, was hier die Regelung ist, aber vielleicht können wir ja auch darüber hinausgehen an dem einen oder anderen Punkt. Das ist ja auch eine Möglichkeit, sowas zu thematisieren. Also, ja. Und ich auch weiß, wie umstritten die sind und wie vielfach, also, umkämpft die auch sind. Und deswegen interessiert mich das auch, ähm, wo eine Institution da steht. Äh, das ist einfach sehr unterschiedlich.»
Je nach Fachrichtung werden in Lehrveranstaltungen auch Inhalte relevant, die buchstäblich «unter die Haut gehen» und die bei Studierenden negative Erinnerungen auslösen können (bspw. an Mobbingerfahrungen in der eigenen Schulzeit) – möglicherweise auch bis hin zu einem Wiedererleben eines Erlebnisses oder von Gefühlszuständen.
Triggerwarnungen oder sogenannte Content Notifications (Inhaltswarnungen) können helfen, solche Folgen zu vermeiden.
Mehr dazu findest du etwas hier: Was ist eine Triggerwarnung und wie setze ich sie ein?
«Es ist häufiger ein Thema, dass Studierende posttraumatische Belastungsstörungen haben oder mit Themen konfrontiert waren in ihrem Leben, die sie auch belasten.»Dozent, Universität
«Es ist häufiger ein Thema, dass Studierende auch vielleicht posttraumatische Belastungsstörungen haben oder mit Themen konfrontiert waren in ihrem Leben, die sie auch belasten. Und da ich, ich habe einen Kurs zu sozialen Problemen, da geht es um ein paar genau dieser Themen, die relativ häufig auch noch schwierig sind. Und da, also auf der einen Seite ist auch ein großes Interesse daran, aber das ist manchmal dann auch schwierig, weil ich auch nicht weiss, was das anrichten kann. Ich weiss, ich habe diese Information ja nicht und das ist auch okay so, völlig. Wir machen jetzt neuerdings auch Inhaltswarnungen und schauen mal ein bisschen, was das dann bringen könnte.»
«Manchmal sind es Themen, die heftig sind. Gewalt, psychische Störungen, Tod, Verlust – und ich fände es so wichtig, dass in der Kursbeschreibung, aber auch vor der Vorlesung, wenn es darum geht, eine Triggerwarnung kommt.»Studentin, Universität
«Triggerwarnungen, ganz fest. Also meine Erfahrung ist gerade so bei, ähm, Sozialarbeit, Sozialpolitik, aber auch Kinder-, Jugend-, Familienstudien. Manchmal sind es Themen, die heftig sind: Gewalt, psychische Störungen, Tod, Verlust. Und ich fände es wirklich so wichtig, dass vielleicht in der Kursbeschreibung, aber auch vor dieser Vorlesung, wo es um das geht, nochmal eine Triggerwarnung kommt, ähm, auch bei Suizidalität, all diesen Themen, ähm, oder auch die Möglichkeit gegeben würde, dass man sich rausnehmen darf. Also, dass wie schon aktiv gesagt wird, heute besprechen wir das, oder in der Kursbeschreibung steht, am dritten Kurstag ist das Thema, ich weiss auch nicht, Fehlgeburt, ähm, falls es Betroffene gibt, oder sonst, ähm, darf man sich dort einfach ohne, ohne dass man, ähm, eine Absenz hat, rausnehmen. Fände das sehr wichtig, ja. Und verständliche Kursbeschreibungen. (.) Ich hatte gerade dieses Semester mit einer Freundin, ähm, die auch von der Fachhochschule kommt, haben wir uns so Kursbeschreibungen hin und her geschickt, wo wir beide so waren: die Dozierenden versuchen sich zu übertreffen mit schwieriger Sprache, und wir waren wirklich so: oh, was wollen die hier? Was, was ist dieser Inhalt dieses Kurses? Also, ja, manchmal kommt man gar nicht raus.»
Wenn Dozierende im Kontext einer Bildungsinstitution sprechen, geschieht dies von einer anerkannten Position aus. Nämlich der Position des institutionell anerkannten und damit gültigen oder legitimierten Wissens. Umso verletzender können daher Formulierungen sein, wenn sie tradierte koloniale Motive oder herabsetzende Stereotype reproduzieren oder gar zur deren Plausibilisierung herangezogen werden.
«Ich finde, Sprache kann wahnsinnig verletzend sein. Auch wenn man nicht einem aktiven Austausch ist, sondern jemand hält eine Vorlesung und die andere Person hört zu und es können Ausdrücke fallen, die die Person verletzen.»Studentin, Universität
«Ich finde, Sprache kann wahnsinnig verletzend sein, auch wenn man vielleicht nicht in einem aktiven Austausch ist, sondern eher so jemand macht eine Vorlesung und die andere Person hört zu. Und es können Ausdrücke fallen, die die Person verletzt oder ja, irgendwie so. Deshalb finde ich es sehr wichtig und auch, dass wie alle Personen genannt werden, die da sind und nicht irgendwie so von einem kleinen, keine Ahnung, Mehrheitsgebilde ausgegangen wird, sondern dass wirklich mitgedacht werden, ach, es gibt ja nicht nur, ich sag jetzt einfach plakativweise, alte Männer, sondern es gibt noch ganz viele andere Menschen und dass man diese in der Sprache mit einschließt. Ähm, ich bin schon auch der Überzeugung, dass Sprache auf eine Art Wirklichkeit schafft und dass man mit Sprache sehr viel bewirken kann. Also, ich habe auch schon gemerkt, wie, (.) dass man sich auch freut oder ich freue mich immer wieder, wenn ich merke, dass mein Gegenüber sich Mühe gibt beim Sprechen oder eben irgendwie so einen Wunsch von mir akzeptiert und dann umsetzt, ja.»
Ein Wissenskanon umfasst Texte und Werke, die als verbindlich gelten und ist das Produkt von Diskursen. In ihm spiegeln sich dominierende Werte und Normen der Mehrheitsgesellschaft (siehe mehr dazu unter «Kanonbildung»).
Vor diesem Hintergrund ist verständlich, warum eine veränderte Vorstellung – ablesbar bspw. an der Entwicklung des Begriffs der Behinderung – sich erst mit einer gewissen Zeitverzögerung im Wissenskanon niederschlagen kann. So sind die kanonischen Schriften und Arbeiten zum Thema Behinderung nach wie vor weitgehend von einer medizinisch-defizitären Sichtweise auf Behinderung geprägt, das zwischenzeitlich aber von einem menschenrechtlichen Verständnis herausgefordert, wenn nicht gar abgelöst wurde. Im Bereich der Kulturwissenschaften dominiert nach wie vor eine eurozentrische Perspektive und es bleiben wichtige Stimmen anderer Weltregionen und Bevölkerungsgruppen ausgeblendet.
Differenzsensible Lehre nimmt einen Kanon daher nicht als selbstverständlich hin, sondern macht ihn als gesellschaftliches Konstrukt bewusst. Dies öffnet die Möglichkeit zur punktuellen Erweiterung und perspektivisch zur Veränderung eines Wissenskanons ohne diesen per se durchzustreichen. Daran können sich auch einzelne Dozierende in ihrer Lehre aktiv beteiligen. Sie können Lektürelisten für Autor*innen öffnen, deren Positionen im (eigenen) Kanon noch keine Berücksichtigung finden. Dies kann allenfalls bereits dadurch geschehen, dass Studierende gefragt werden, ob und welche Lektüre sie in die Lehrveranstaltung einbringen können/wollen.
«… sind sowohl der Wissenskanon wie auch die Curricula an den Schweizer Hochschulen noch einiges davon entfernt sowohl Unterschiede als auch Ungleichheiten wahrzunehmen und in ihre Strukturen zu integrieren …»Dozent, Fachhochschule
«Ich glaube, meines Erachtens sind sowohl der Wissenskanon, äh, wie auch die meisten Curricula an Schweizer Hochschulen noch einiges davon entfernt, sowohl Unterschiede als auch Ungleichheiten wahrzunehmen und in ihre Strukturen zu integrieren. Ähm, nach wie vor ist der Unterricht zum Thema Behinderung in den klassischen Fächern, welche sich mit den Themen Gesundheit, Normalität, Behinderung etc. auseinandersetzen, wie soziale Arbeit, Heilpädagogik, Rehabilitationswissenschaft oder Studienfächer aus dem Bereich Gesundheit nach wie vor sehr an traditionellen, klassischen Bildern von, äh, oder Verständnissen von Behinderung orientiert. Und fast ausnahmslos wird ein eher defizitorientiertes, veraltetes Bild von Behinderung auch im Wissenskanon immer wieder reproduziert. Äh, ich habe vorhin vom medizinischen, veralteten, individuellen Modell von Behinderung gesprochen. Ich glaube, das ist da immer noch sehr, ähm, dominant. Und ein menschenrechtliches Verständnis zum Beispiel von Behinderung hat da, glaube ich, noch nicht so viel Eingang gefunden.»
«Es gibt aber auch Dozierende, die nachfragen, ob wir Texte einbringen möchten.»Studentin, Universität
«Ja, es gibt Dozierende, die, die sagen, ähm, oder, die erklären sich, weshalb jetzt die Texte eher alt-weiss-männlich sind, ähm, oder aus dem globalen Norden sind. Das ist oft, (.) oder ich nehme es mehr so wahr wie eine Erklärung, das müssen wir halt, das ist so vorgegeben, mhm. Ja, ähm, finde ich oft sehr schade dann, weil, wie eigentlich gezeigt wird, uns ist diese Problematik bewusst, aber wir machen wie nichts dagegen, oder noch nicht. Ähm, es gibt aber auch Dozierende, die zum Beispiel nachfragen, ob wir Texte einbringen möchten. Ähm, manchmal machen sie so bei Moodle, wie ein, also das ist unsere Studienplattform, machen sie wie so eine Application, wo die Studierenden eigene Texte noch hochladen können, die interessant sind, die passen könnten. Genau, das finde ich noch schön.»
«In den Disability Studies ist das die Regel, aber überall sonst wird immer über Behinderung gesprochen, statt dass Menschen mit Behinderung selbst zu Wort kommen.»Dozent, Fachhochschule
«Ich versuche zum Beispiel halt Stimmen auch zu nehmen, die ganz klassisch, ähm, von Menschen mit Behinderungen zum Beispiel selber geschrieben wurden. Ähm, ist immer noch die ganz große Ausnahme in der Disability Studies, ist das die Rede, aber überall sonst wird eigentlich immer über Behinderung gesprochen, statt dass Menschen mit Behinderungen selbst zu Wort kommen. Also das versuche ich sicherlich zu integrieren. Ähm, ich versuche zum Beispiel in Lehrveranstaltungen auch häufig Menschen mit Behinderungen einzuladen, Interviews zu führen, um die Lebensrealitäten dort sichtbar zu machen. Und ich glaube, was ebenfalls ganz wichtig ist und auch in unseren Hochschulstrukturen schwierig ist, sind Lerntandems oder Lehrtandems, äh, zu installieren, wo Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam über diese Themen auch unterrichten können. Und häufig fehlen ja dann die finanziellen Mittel, äh, es fehlen Ressourcen anderer Art, die dazu zur Verfügung stehen müssten. Und das ist ein ziemlicher Kampf, das entsprechend zu implementieren.»
«In der Soziologie haben wir einen sehr breiten Kanon, wo es auch viel um Mehrsprachigkeit geht (…) aber wenig mutig, wenig, das nicht von anglophonen oder eurozentristischen Autor*innen erstellt wurde.»Studentin, Pädagogische Hochschule
«Also da mein Studienfach auch ein bisschen teilweise ins Medizinische reingeht, aufgrund von ICD, Thema mit Behinderung, ohne Behinderung, diese Diversitätsmarker behandelt, da ist schon irgendwie sehr klar, ähm, cis, männlich, weiß geprägt, weil einfach die medizinische Literatur dementsprechend bis jetzt so geprägt ist und wenig von Betroffenen irgendwie Literatur oder Zugänge geschaffen werden, die für die Studierenden zugänglich sind. Ich erlebe einfach, dass es sehr fachspezifische Unterschiede gibt, zum Beispiel in Soziologie haben wir einen sehr breiten Kanon, wo es auch viel um Mehrsprachigkeiten geht, ähm, auch viel deutsche und auch englische Zugänge hat, was ja auch schon mehr Diversität reinbringt, aber eigentlich wenig mutig oder wenig, ähm, das nicht von, von, ähm, anglophonen oder, ähm, eurozentristischen Autor:Innen erstellt wurde.»