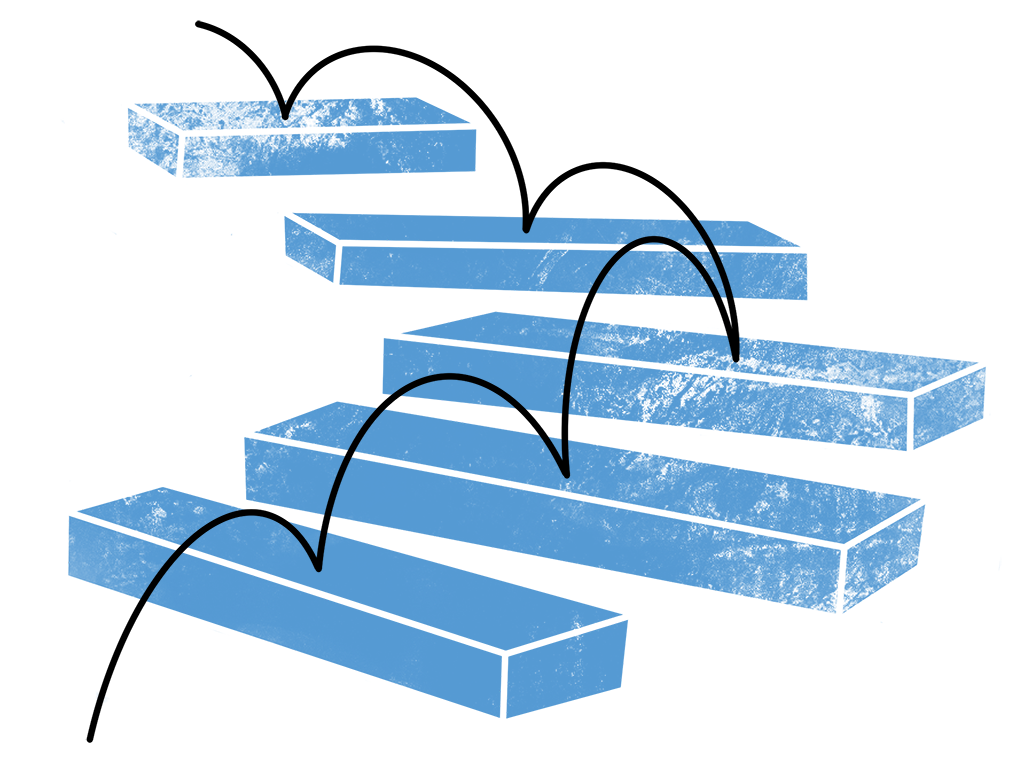Situiertheit und Selbstvertretungen
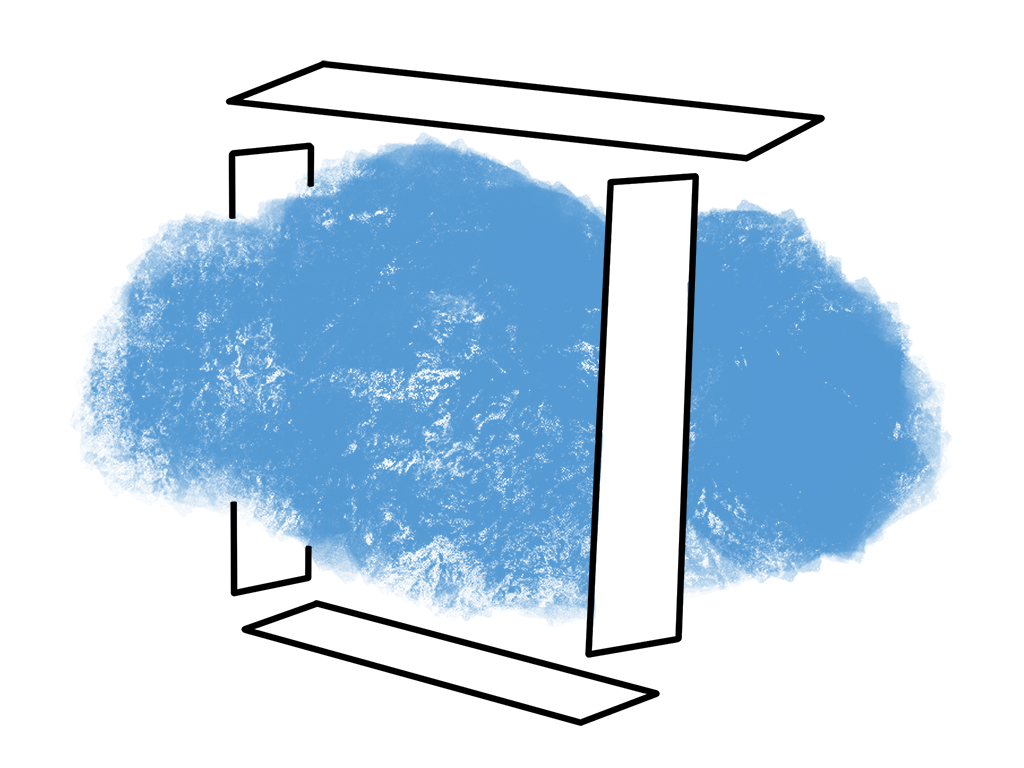
Der Begriff ‘Selbstvertretung’ hat besonders im Kontext der Bewegung behinderter Menschen an Bedeutung gewonnen. Er beschreibt die Praxis, dass Menschen mit Behinderungen für sich selbst sprechen und ihre eigenen Interessen und Rechte vertreten, anstatt dass Dritte für sie sprechen.
Marginalisierte Positionen an der Hochschule
Bestimmte Perspektiven und Erfahrungshintergründe sind an der Hochschule weniger stark vertreten als andere. Behinderung ist hierbei ein Faktor. Ein weiterer Aspekt ist die soziale Selektivität im Schweizer Bildungssystem. Die Studierenden stammen überdurchschnittlich oft aus Familien, in denen bereits mindestens ein Elternteil studiert hat, während Studierende aus Nicht-Akademiker-Familien unterrepräsentiert sind. Allerdings variiert die soziale Herkunft der Studierenden nach Hochschultyp und Fachbereich stark.
So genannte ‘First Generation Students’ können an der Hochschule mit Herausforderungen unterschiedlicher Art konfrontiert sein.
Situiertes Wissen und Selbstreflexion
Wissenschaftliches Wissen beruht immer auf Vorannahmen und Normen. Aus feministischer und postkolonialer Perspektive wird diese Kontextabhängigkeit von Wissensproduktionen mit dem Begriff des ‘situierten Wissens’ beschrieben. Auch als Lehrende bringen wir u.a. biografisch geprägtes Vorwissen mit, dass unsere Wahrnehmung und Handlungen beeinflusst. Wenn wir Wissen als situiert verstehen, können wir auch die damit einhergehenden Ein- und Ausschlüsse wahrnehmen und thematisieren lernen.
Hierfür braucht es ein Bewusstsein für die eigene soziale Positioniertheit, für eigene strukturelle Privilegien oder auch Marginalisierungen. Selbst zu benennen, aus welcher Position gesprochen wird, zeigt an, dass auch die eigenen Beiträge als situiert verstanden werden. Es kann Ausschlüsse vermeiden, die vorgeblich neutrale, universale Perspektiven bewirken. Häufig wird etwa aus privilegierter Position unhinterfragt im ‘Wir’ über ‘die Anderen’ gesprochen, obgleich in der Runde auch andere marginalisierte Erfahrungen und Perspektiven vertreten sind.
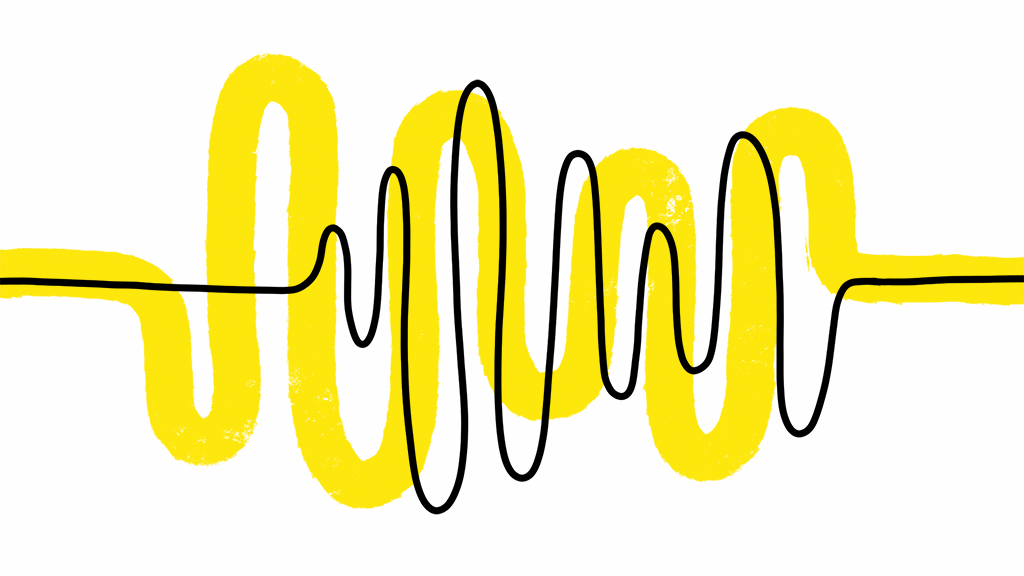
«Ich find’s schon cool, wenn Dozierende vielleicht auch etwas teilen von ihrem Hintergrund, sodass auch vielleicht ihre Privilegien ein bisschen klar werden. Was ich cool fände, wäre, wenn vielleicht Dozierende von Anfang an sagen, ‚hey ich probiere so gut möglich mein Verhalten, meine Sprache und so weiter und so fort zu reflektieren. Das ist aber zum Teil halt auch nur möglich, wenn ich auf Sachen angesprochen werde, die ich vielleicht nicht perfekt mache. Also bin ich immer offen für Feedback‘. Dass halt nicht erst am Ende vom Seminar dann diese Evaluation kommt. Weil es halt wirklich erst am Ende passiert. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich die gleiche dozierende Person wieder habe, ist halt vielleicht relativ klein. Und bis dann ist es vielleicht auch schon wieder vergessen.»
Machtverhältnisse in der Lehre
In sozialen Interaktionen kommt es unweigerlich zur Reproduktion von Machtverhältnissen. Dies gilt auch für Lehrveranstaltungen. Keine Person, egal wie umfassend informiert und reflektiert, kann sich gänzlich frei von normalisierten Denkweisen machen. Indem wir uns bewusst werden, wie gesellschaftliche Machtverhältnisse unser Denken, Handeln und Fühlen prägen, können wir auch dazu Stellung beziehen.
Um Teilhabe und Zugehörigkeit zu ermöglichen, bedarf es stets auch jenen, die bereit sind, Macht und Raum zu teilen. So kann zum Beispiel der Einbezug von Studierenden in die Gestaltung des Lehrprogramms dazu beitragen, die Lehre für diese relevanter und ansprechender zu gestalten.
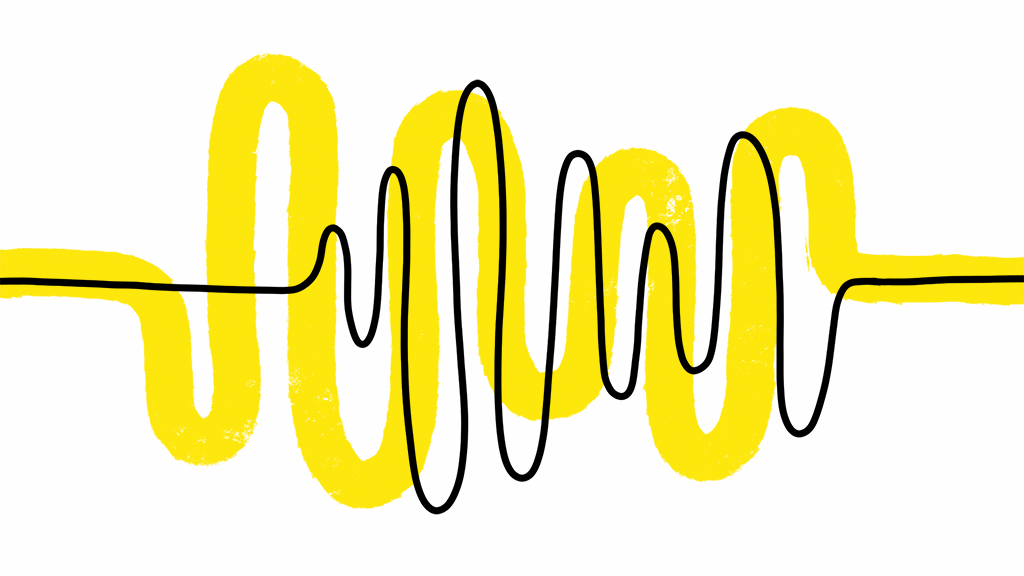
«Also, ich habe das Gefühlt, es spielt eine wahnsinnig grosse Rolle. Und es ist schwierig, diese Rolle wegzunehmen. Ich finde es auch sehr schwierig, diesen Stempel zu haben. Ich merke immer wieder, mir ist es wahnsinnig unangenehm wenn ich in Vorlesungen sitze, wo es zum Beispiel um Armut und Sozialhilfe geht und zu wissen, dass ich mein ganzes Leben mit meiner Familie von Sozialhilfe gelebt habe und eigentlich erst seit vier Monaten raus bin. Und dort merke ich immer so, ah wir reden jetzt über ‚diese armen Menschen‘, die dieses und jenes haben und schauen uns an, an was das liegt und böböbö…, und merke dann immer wieder so, ja, aber ich gehöre ja eigentlich zu denen und nicht zu denen, die hier reden. Und das finde ich immer mega schwierig. Also ich merke, das sind so Prozesse in mir selber, wo ich mich nicht wohl fühle, wo ich oft auch so denke, ‚woa, was redet ihr hier da? Das ist so weit weg von meinem Leben.‘ Aber wegdenken kann ich es nicht.»
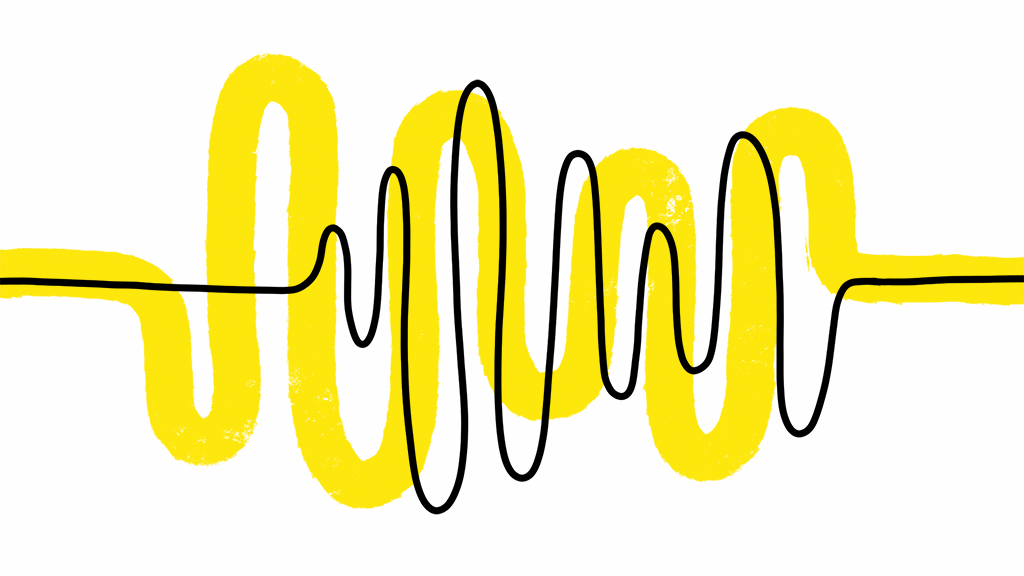
«Ich glaub wichtig ist, dass man sich der eigenen Rolle, der eigenen Situiertheit, auch der eigenen Privilegien vor allem natürlich auch bewusst ist. Das kann man nicht häufig genug mit sich selber versuchen und ich glaube, auch wenn man das häufig versucht, trotzdem sich einzugestehen, dass wir alle immer wieder diskriminieren, ob wir es wollen, oder ob wir es nicht wollen. Ich hab vorher das Beispiel erwähnt mit der Studentin mit einer Hörbehinderung, ich selber lebe mit einer Mobilitätsbehinderung, meine, ich wäre einigermassen sensibilisiert und es passiert mir trotzdem. Und ich glaube, das sich auch zuzugestehen, dass wir das alle immer wieder tun, einfach weil wir die verschiedenen Lebensrealitäten unterschiedlicher Personengruppen nicht immer ausreichend kennen. Und wenn wir das wissen, dass wir das ja immer tun, so glaube ich, führt die Selbstreflexion und die eigene Position/Situiertheit dazu, dass man eben aktiv die vorher bereits erwähnten Räume erschafft. Wo man sich austauschen kann, (im Sinne von) ‚hey, stimmt das für dich? Wie ist das bei dir angekommen? Kann ich es besser machen? Kann ich es anders machen?‘ Ich glaube, diese Reflexion braucht es immer wieder, bei sich selber, aber dann auch mit den anderen Menschen gemeinsam zusammen.»
Reflexionsfragen
- Bin ich mir bewusst, dass die Studierenden unterschiedliche Erfahrungen und Erwartungen mitbringen?
- Aus welcher Position/Perspektive heraus spreche ich?
- Wie beeinflusst diese Position/Perspektive meine Lehre? Welche Chancen und Herausforderungen birgt sie?
- Sehe ich Möglichkeiten, im Rahmen meiner Lehre selbstvertretenden Stimmen (noch mehr) Raum zu geben?
Weiterführende Materialien
Webseiten
- Projekt «Stark hoch drei», Öffnung von Hochschulen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen, HfH
- Artikel: «Wenn in der Familie noch niemand studiert hat» von Kai Vogt in der Zürcher Studierendenzeitung, 2023
- Projekt «Selektivität aufgrund sozialer Herkunft an Schweizer Hochschulen», Universität Freiburg CH
- ArbeiterKind.de, Förderung des Hochschulstudiums von Nicht-Akademikerkindern
- Handreichung «Diskriminierungskritische Lehre. Denkanstösse aus den Gender Studies», Humboldt Universität Berlin
- Anleitung Gruppenübung «Privilege Walk», Charta der Vielfalt e.V.
Gruppenaktivität, die dazu dient, strukturell bedingte gesellschaftliche Ungleichverhältnisse sichtbar zu machen - BFS (2021). Studien- und Lebensbedingungen an den Schweizer Hochschulen, Statistik der Schweiz 15, Bildung und Wissenschaft. Bundesamt für Statistik (BFS), Neuchâtel. (open access)
Webseiten zu Situiertheit
- Glossareintrag «Hä, was heisst denn Privilegien?», Glossar Hä?, Missy Magazine
- Priviligiertheit wahrnehmen, diskrit, Diskriminierungskritische Perspektiven an der Schnittstelle Bildung/Kunst, Kunsthochschule Mainz
- Selbstverortung versuchen, diskrit, Diskriminierungskritische Perspektiven an der Schnittstelle Bildung/Kunst, Kunsthochschule Mainz
- Erklärung des Begriffes ‘Situated Knowledge’, Bestandesaufnahme des Forschungsdiskurses, ZHdK
- Lehrinhalt: Situiertes Wissen statt Annahme von Neutralität, Toolbox Gender und Diversity in der Lehre, Freie Universität Berlin
Webseiten zu Selbstvertretung
- PDF: Selbstvertreter*innen bestimmen mit!, Bundesvereinigung für Lebenshilfe
- Empowerment/Selbstvertretung, Transfer für Bildung, Essen
- Selbstvertretung, Na klar. Seite mit Informationen rund um das Thema Selbstvertretung
Literatur
- Danz, Simone (2023). Ent-hinderung. Ein Leitfaden. Weinheim: Beltz Juventa. (Link zum Verlag)
- Haraway, Donna (1988). Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective. (S. 575-99) Feminist Studies 14, Nr. 3. https://doi.org/10.2307/3178066
- Theuerl, Marah (2024). Studienerfahrungen im Spannungsfeld von Differenz und Zugehörigkeit. Zur Umgangsweisen von Studierenden mit Rassismus und Diskriminierung. Weinheim: Beltz Juventa. (Link zum Verlag)