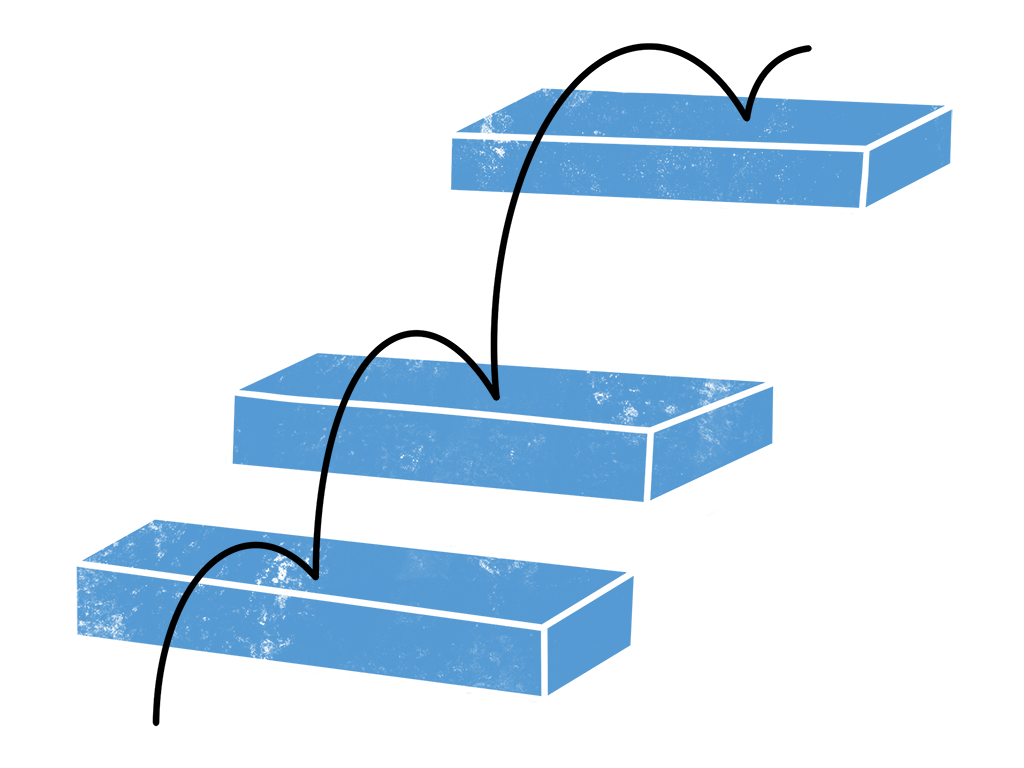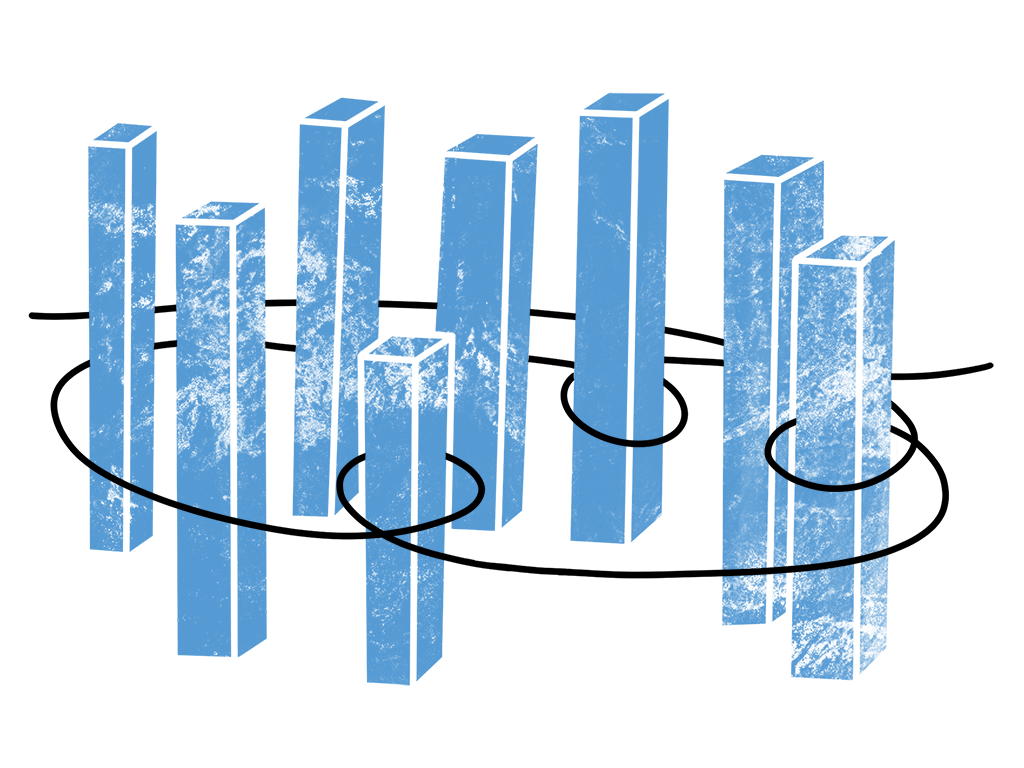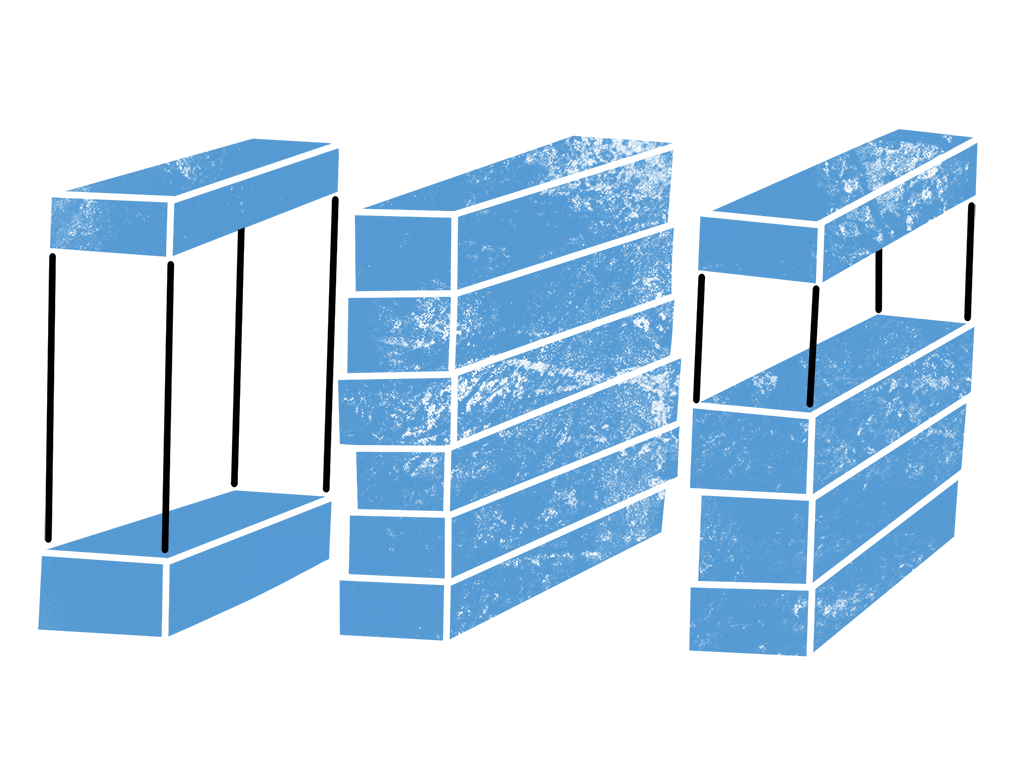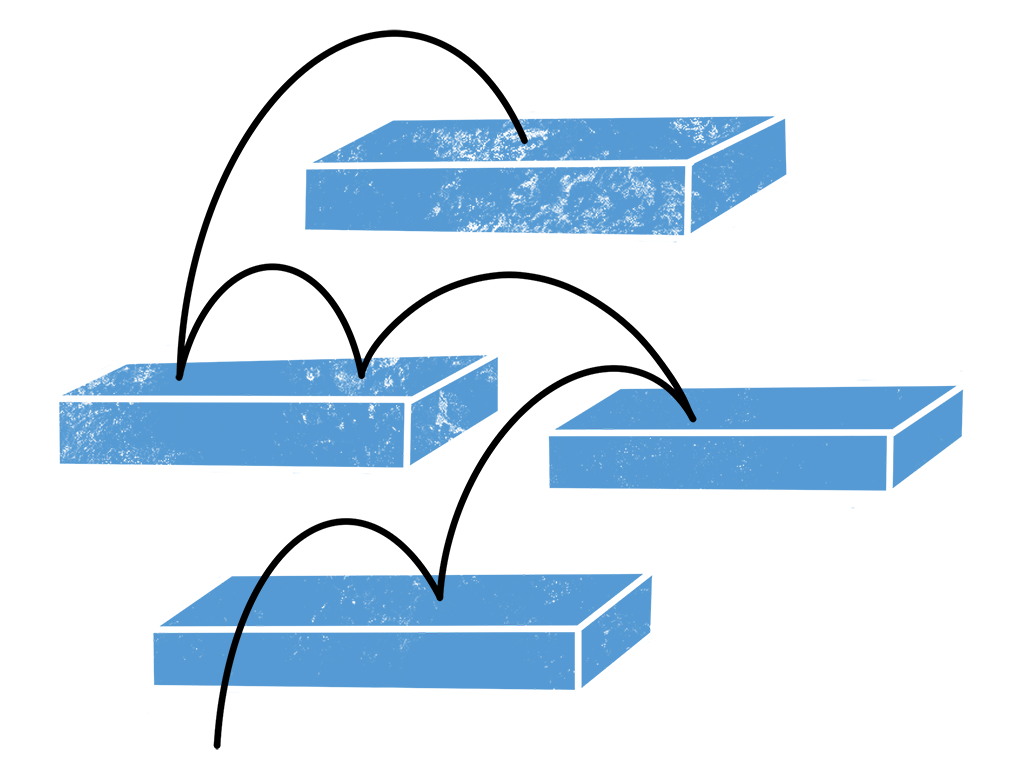Institution Hochschule
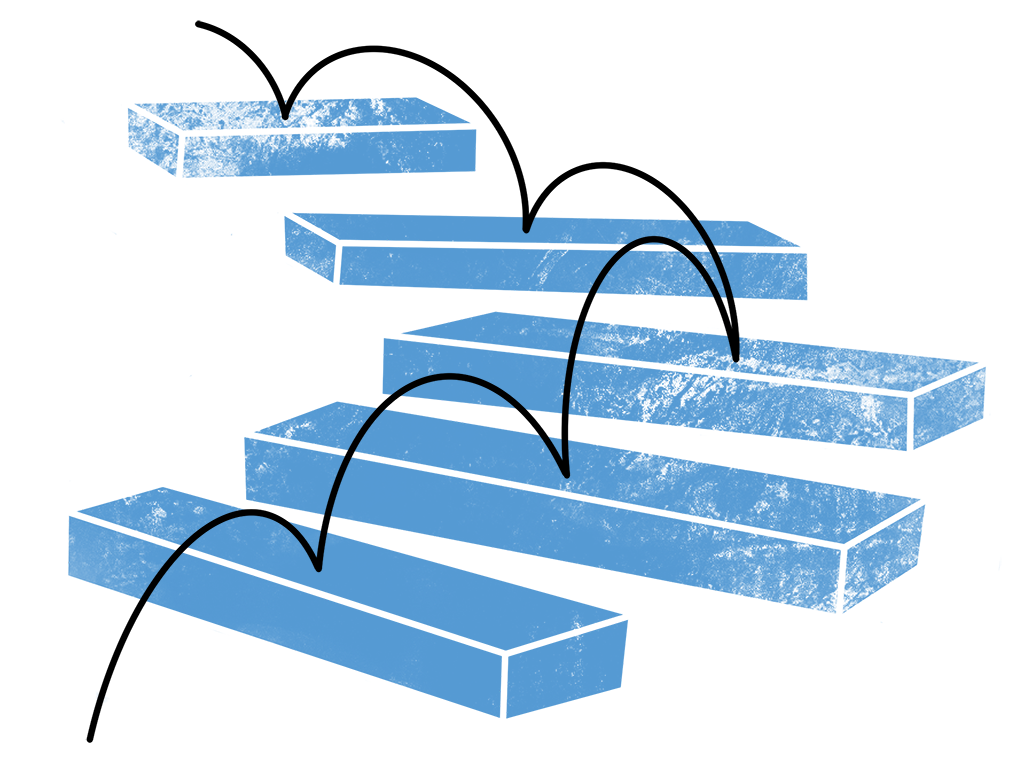
An der Hochschule braucht es institutionelle Rahmenbedingungen, die Lehrenden Resonanz und Förderung bieten. Solange Differenzsensibilität von der Initiative und dem Engagement einzelner Lehrender abhängt, bleibt deren Wirkung begrenzt und es kann zu Überforderungen bzw. Überlastungen kommen.
Strukturelle Verankerung differenzsensibler Lehre
Es ist problematisch, wenn sich Hochschulen für Diversity aussprechen, ohne umfassende strukturelle Veränderungen der gesamten Institution anzustreben. Sara Ahmed beschreibt die damit einhergehende Täuschungsgefahr treffend: „Tatsächlich können Gleichheit und Diversity als Masken dienen, um den Anschein zu erwecken, sich bereits verändert zu haben.“ (Ahmed 2018: 122)
Differenzsensible Lehre erfordert deshalb ein angemessenes institutionelles Umfeld wie etwa eine angemessene, unterstützende räumliche und technische Infrastruktur. Zudem sind vordefinierte Prozesse für gezielte Unterstützungsleistungen, wie beispielsweise den Nachteilsausgleich für Studierende mit Behinderung, notwendig.
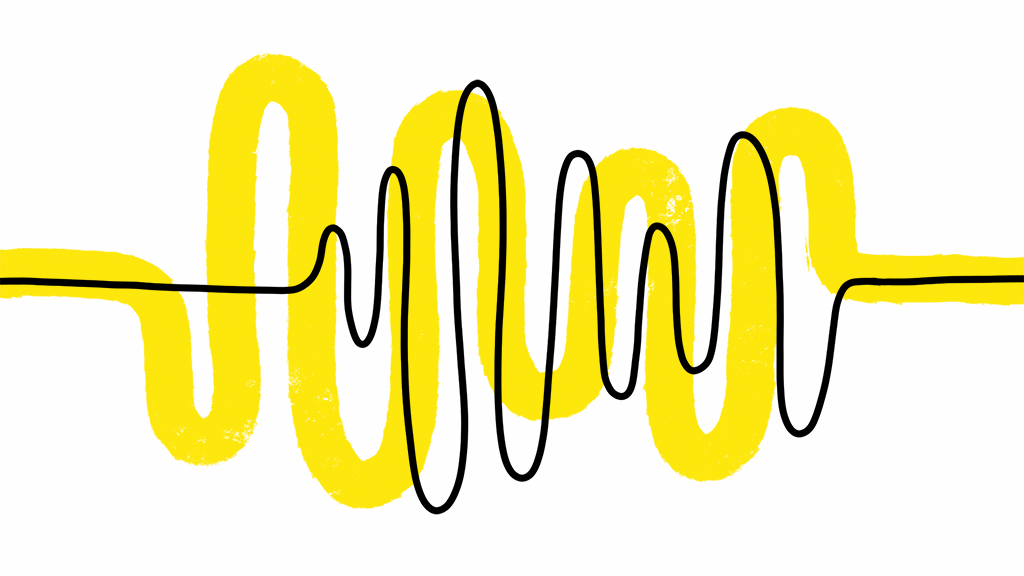
«Sehr häufig bleibt vieles einfach an der Lehrperson hängen, was kontraproduktiv in mehrfacher Hinsicht ist. Ich glaub es verkennt die Situation, dass es eine strukturelle Thematik ist und es reduziert auch die Motivation vieler sehr engagierter Lehrpersonen mehr zu machen, wenn sie alles alleine machen müssen.»Dozent, Fachhochschule
«Also ich glaube, die grössten Hürden sind jeweils fehlende Strukturen bei der Hochschule. Es beginnt beispielsweise schon mit nicht-hindernisfreien Räumen, die Studierende manchmal in verschiedener Hinsicht ausschliessen. Wenn sie auch irgendwo weiter entfernt sind, wo man mit einem nicht-hindernisfreien ÖV nicht gut hinkommt. Es geht weiter mit Exkursionen etc. Das hat ganz viele strukturelle Implikationen, die zumeist nicht mitgedacht werden. Wenn ich das auf die Lehre alleine begrenze, dann ist ja eine umfassende differenzsensible Lehre, welche die Bedürfnisse der unterschiedlichsten Gruppen berücksichtigt…, eine solche Lehre kann ziemlich anspruchsvoll sein. Also ich habe das Beispiel vorhin gebracht (von) Studierenden, die Folien hindernisfrei aufbereitet haben müssen. Das ist dann für die Lehrperson auch sehr aufwendig, wenn diese keine Unterstützung erhält. Und ich glaube dafür braucht es spezialisierte Dienste. Entweder an einer Hochschule selbst, oder auch hochschulübergreifende Angebote. Und beides existiert in der Schweiz erst in den Anfängen. Also sehr häufig bleibt vieles einfach an der Lehrperson hängen, was kontraproduktiv in mehrfacher Hinsicht ist. Ich glaube, es verkennt die Situation, dass es eine strukturelle Thematik ist und es reduziert auch die Motivation vieler sehr engagierter Lehrpersonen hier mehr zu machen, einfach wenn sie alles alleine machen müssen. Ich glaube hier fehlt es an einer langfristigen Perspektive und an einer langfristigen Umsetzung der normativen Vorgaben. Denn sowohl das nationale, vor allem aber auch das internationale Recht, geben klar vor, dass ein chancengleiches Studium möglich sein muss – für alle Studierenden. Davon sind wir aber meines Erachtens immer noch ein ziemliches Stück entfernt. Vor allem vielleicht auch deshalb, weil die meisten Hochschulen ihre eigenen, ganz individuellen Wege einschlagen. Es fehlt an einer nationalen Koordination wie auch an einem nationalen Controlling. Es braucht hier beispielsweise im Bereich Behinderung klare Umsetzungskonzepte der Behindertenrechtskonvention, wie man das denn tatsächlich machen will. Es braucht Strukturen dazu und es braucht von der Bildungspolitik, dass diese das thematisiert und auch einfordert. Und ich glaube, das fehlt in der Schweiz immer noch fast komplett.»
Repräsentationsverhältnisse überdenken und verändern
Neben der Selbstreflexion der Dozierenden ist eine institutionelle Reflexivität nötig. Dazu gehört, dass Hochschulen sich über eine diversere Zusammensetzung der Dozierenden bzw. der Hochschulmitarbeitenden insgesamt Gedanken machen. Hochschulen stehen vor der Aufgabe, bislang untervertretenen sozialen Gruppen mehr Repräsentation zu ermöglichen.
Sie sind zudem dazu angehalten, ihre Organisation und Studienbedingungen angemessen auf die Diversität ihrer Mitarbeitenden und Studierenden abzustimmen. Hierzu gilt es Exklusionsmechanismen kritisch zu überdenken und Zugangshürden abzubauen, um Chancengleichheit zu stärken.
Institutionalisierte Räume der gemeinsamen Reflexion
Hochschulen brauchen institutionalisierte Räume, in denen sich Dozierende und andere Hochschulangehörige regelmässig über Aspekte von Diversität und Diskriminierung austauschen und weiterbilden können. Dazu gehören Formate des gemeinsamen Lernens von Dozierenden, Studierenden und Menschen, die in Selbstvertretung ihre Anliegen vorbringen. Dies beispielsweise im Sinne von ‘Communitiy Learning’ oder Weiterbildungsateliers.
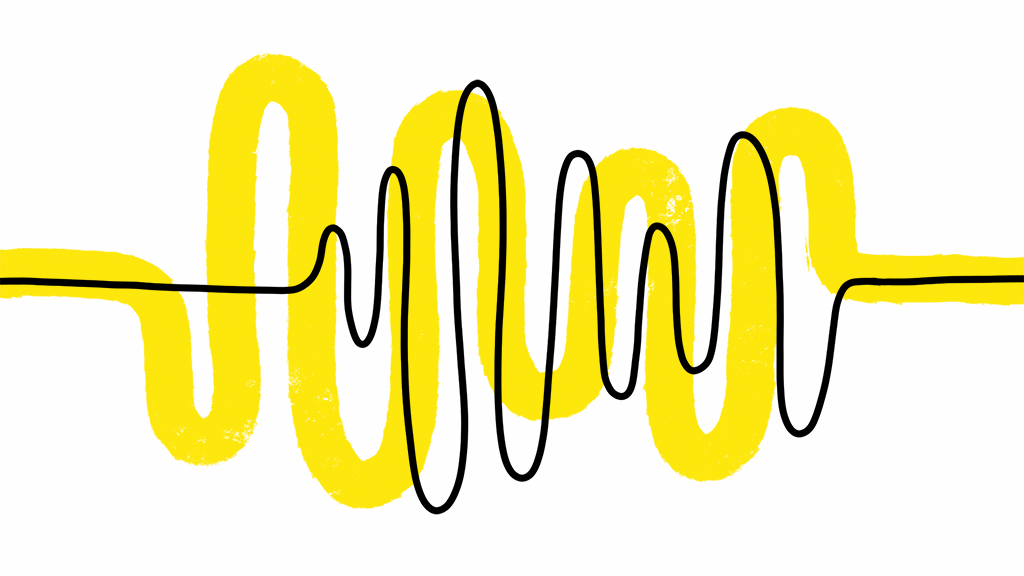
«Ich würde sagen, im Grossen ist differenzsensible Lehre an unserer Hochschule personenabhängig und nicht strukturell verankert.»Dozentin, Pädagogische Hochschule
«Grundsätzlich glaube ich, dass Hochschulen heute das Thema gar nicht mehr ignorieren können. Ich glaube, dass da irgendwie auch eine strukturelle Notwendigkeit ist, also dass Hochschulen sich dem Thema ‚Umgang mit Diversität‘ nicht mehr entziehen können. Ich würde sagen, es gibt Unterstützung für entsprechende Projekte. Auch bei uns an der Hochschule würde ich das absolut unterstreichen. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass es aber nicht so ist, dass die Hochschule per se sagt, ‚das ist uns ein Anliegen, das wollen wir jetzt machen‘. Das heisst, es ist nicht ein Diktat von oben, wo einfach klar ist, ‚hey, wir wollen eine diversitätssensible Hochschule sein‘. Sondern es ist eher so, dass wenn an die Hochschulleitung herangetragen wird, ‚hey, das ist ein wichtiges Thema, wir haben da die und die Idee, das und das wäre gut‘, dass dann Bereitschaft da ist, zu sagen, ‚ja, okay, das sehen wir‘. Und wenn man dann sagt, ‚ja, da bräuchte es Gelder‘, dann wird es schon schwieriger. Aber auch da gibt es irgendwie noch Möglichkeiten. Aber ich würde sagen, im Grossen ist differenzsensible Lehre an unserer Hochschule personenabhängig und nicht strukturell verankert.»
Reflexionsfragen
- Sehe ich Möglichkeiten, mich in der Hochschule einzubringen, um differenzsensible Lehre strukturell zu verankern?
- Wie fällt die Repräsentation in meinem Fachbereich aus? Sind die Beschäftigten und Studierenden divers zusammengesetzt? Welche Einflüsse hat dies möglicherweise auf die Lehre?
- Welche Räume für kollegialen Austausch, Reflexion und Bildung zum Thema Diskriminierung und differenzsensible Lehre gibt es an meiner Hochschule und könnte ich nutzen?
- Wie gehe ich mit meinen eigenen Grenzen und Überforderungen um und an wen kann ich mich wenden, um mir Rat und Unterstützung zu holen?
Weiterführende Materialien
Webseiten
- Diversity Prisma, Eine organisationale Standortbestimmung, FHNW
- Diversity in Innovation,Toolkit: Women & Diversity in Innovation, FHNW
Literatur
- Ahmed, Sara (2012). On being included. Racism and Diversity in Institutional Life, Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822395324
- Ahmed, Sara (2024). Feminist Killjoy: Das Handbuch für die feministische Spassverderber:in. Münster: UNRAST e.V. (Link zum Verlag)
- Le Breton, Maritza, Burren, Susanne (2024). Die Hegemonie kann nur irritiert werden, wenn wir eine andere Hegemonie anstreben und dafür brauchen wir Allianzen – Ein Gespräch mit María do Mar Castro Varela.In: Le Breton, Maritza, Burren, Susanne Bachmann, Susanne (Hrsg.). Differenzkritische Perspektiven auf Fachhochschulen und Universitäten – Analysen und Interventionen. (S. 13-27). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-44988-9
- Karakaşoǧlu, Yasemin (2018). Ein rassismuskritischer Blick auf das institutionelle Selbstverständnis von Hochschulen im Spannungsfeld von Internationalität, Interkulturalität und Diversity-Management.In: standpunkt: sozial 2. (S. 29–39).
- Klingovsky, Ulla, Dankwa, Serena O., Filep, Sarah-Mee, Pfründer, Georges (2021). Bildung.Macht.Diversität – ein verschlungenes Feld. In: Dankwa, Serena O. et al. (Hrsg.). Bildung.Macht.Diversität. (S. 17-35). Bielefeld: transcript. (open access)
- Mecheril, Paul, Rangger, Matthias, Tilch, Andreas (2022). Migrationsgesellschaftliche Öffnung von Organisationen. In: Mecheril, Paul, Rangger, Matthias (Hrsg.). Handeln in Organisationen der Migrationsgesellschaft. (S. 255-317). Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-19000-2